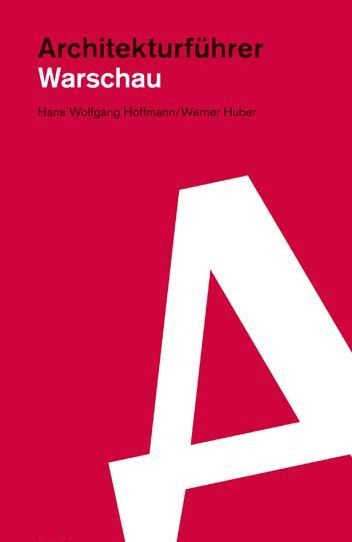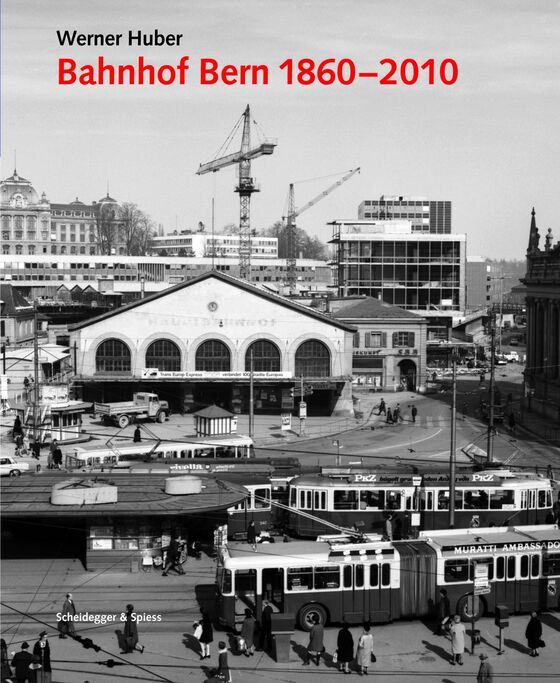Artikel
Das längste Haus der Schweiz – die Genfer Grosssiedlung Le Lignon setzt bis heute Massstäbe
Vor sechzig Jahren war in Genf die Wohnungsnot ebenso gross wie heute. Die Grosssiedlung Le Lignon trug mit 2780 Wohnungen zur Linderung bei. Seit 2009 steht sie unter Denkmalschutz.
Die Satellitenstadt Le Lignon bei Genf ist ein gebauter Superlativ: Über einen Kilometer lang ist die geknickte, y-förmige Wohnhausscheibe. 12 bis 15 Geschosse zählt sie in der Höhe, daneben setzen zwei Turmhäuser mit 26 und 32 Stockwerken vertikale Akzente. Ein feines Gitter aus Aluminiumprofilen überzieht die Fassaden. Aus der Ferne betrachtet flimmern sie im Licht, aus der Nähe erinnern die quadratisch geteilten Flächen an ein Mondrian-Bild. Dahinter verbergen sich 2780 Wohnungen.
Addiert man die Zahl der Zimmer – nach Genfer Zählweise inklusive Küchen –, kommt man auf 10 687. Im Zentrum der «Cité satellite» stehen ein Einkaufszentrum, zwei Kirchen, Kindergärten, ein Schulhaus, Alterswohnungen und vier Tiefgaragen. Man kennt andere Grosssiedlungen wie das Tscharnergut in Bern oder die Grünau in Zürich. Doch in den Dimensionen und in der architektonischen Stringenz ist Le Lignon einmalig in der Schweiz.
Anlass für den Bau der Cité war die Wohnungsnot. Allein für die Jahre 1962 bis 1965 rechnete der Kanton mit einem Bedarf von 15 000 Wohnungen. Der Bau von sogenannten Grands Ensembles und Cités satellites sollte die Lösung bringen.
Auf einem ehemaligen Landwirtschaftsgut zwischen der Rhone und dem Bach Nant in der Gemeinde Vernier plante ein Architektenteam um Georges Addor und Dominique Juillard Le Lignon. Die Konzentration der Wohnungen auf wenige, dafür umso höhere und längere Gebäude erlaubte es, den grössten Teil des Terrains frei zu halten. 1963 begannen die Bauarbeiten, zwei Jahre später zogen die ersten Mieter ein. 1971 waren die letzten Häuser fertig.
Wohnungen mit Weitblick
Insgesamt bestehen die Grossformen aus 84 einzelnen Häusern. Allein 74 Eingänge zählt die lange Wohnhausscheibe. In jedem dieser Häuser gibt es pro Geschoss bloss zwei Wohnungen. Praktisch alle sind nach dem gleichen Muster gestrickt: Im Kern liegen die offene Küche, das Bad und die separate Toilette. Auf der einen Seite sind die Schlafzimmer aufgereiht, auf der anderen liegt der Wohn- und Essbereich. Eine filigrane Konstruktion aus Mahagoni und Glas trennt eine Loggia ab.
Sämtliche Wohnungen sind nach zwei Seiten ausgerichtet. In den oberen Etagen geht der Blick Richtung Jura und den Flughafen oder zum Jet d’Eau und zum Montblanc. Nach Deutschschweizer Zählung haben die Wohnungen 2½, 3½ oder 4½ Zimmer, Wohn- und Essraum, die Küche und die Sanitärräume sind bei allen identisch.
Jedes vierte Geschoss ist allseitig eingeschnürt. Laubengänge verbinden die einzelnen Häuser miteinander. Diese «coursives» erschliessen die Wasch- und Trockenräume, die hier angesiedelt sind, und sie dienen als Fluchtwege. Das Pendant zu den Laubengängen sind die gedeckten Wege, die im Erdgeschoss über einen Kilometer den Hauseingängen entlangführen.
Die Wände sind mit Marmor belegt, die Haustüren aus Mahagoni und Glas konstruiert. Für jeden der 84 Hauseingänge hat Hans Erni aus einer eloxierten Kupferplatte ein Bild zum Thema «Candide» von Voltaire entworfen. Massenwohnungsbau kann auch hochwertig gestaltet sein.
Angesichts der schieren Masse an Wohnungen denkt man unweigerlich an Plattenbau – und liegt damit falsch: Die Betonkonstruktion von Le Lignon wurde an Ort gegossen. Die Effizienz erreichte man durch eine Standardisierung des Bauprozesses: Wohnungsgrosse Eisenschalungen ermöglichten es, Wände und Decken in einem Arbeitsgang zu betonieren. Dank dieser monolithischen Betonkonstruktion liessen sich Armierung und somit Baukosten sparen.
Vor dieses vieltausendzellige Betonskelett wurden die 14 000 Teile der 86 600 Quadratmeter grossen, von der Tragkonstruktion unabhängigen Vorhangfassade montiert. Ein Pionier für diese Bauweise war 1952 das Lever House in New York, 1957 erlebte sie am PKZ-Haus an der Zürcher Bahnhofstrasse ihre Schweizer Premiere.
Georges Addor, der federführende Architekt von Le Lignon, machte die Vorhangfassade aus transparenten und grau emaillierten Gläsern zu einem Merkmal seines Schaffens. Zum ersten Mal verwendete er diese «mur rideau» am Hôtel de l’Ancre in Genf, später in den Überbauungen Meyrin Parc und Ciel bleu in Meyrin sowie am Hotel Intercontinental in Genf.
Kritische Betrachtung
Als Le Lignon entstand, war «Satellitenstadt» ein positiver Begriff. Der Mensch beherrschte das Atom und eroberte den Weltraum. Diesem Zukunftsglauben widmete die Expo 1964 im nahen Lausanne einen ganzen Sommer. Kurz nachdem die letzten Mieter ihre Wohnungen in Le Lignon bezogen hatten, begann das Pendel in die andere Richtung auszuschlagen. Öl- und Wirtschaftskrise zeichneten düstere Zukunftsbilder.
In der Architektur bediente die Postmoderne die Sehnsucht nach der vermeintlich guten alten Zeit. In seiner mit düsteren Schwarz-Weiss-Fotos illustrierten Anklageschrift «Bauen als Umweltzerstörung» von 1973 stellte Rolf Keller Le Lignon einer Überbauung in Leningrad gegenüber und nutzte eine Aufnahme der Fassade als Symbolbild für die Vereinsamung in der Masse.
«Cages à lapins», Hasenställe, nennen denn auch viele Genferinnen und Genfer die Cité du Lignon. Soziale Probleme gab es durchaus, leben doch Menschen aus 120 Nationen hier. Doch ein Ghetto, wie die Medien suggerierten, war Le Lignon nie. Allein die Eigentümerstruktur verhinderte das: Von den 84 Häusern wurden 53 von privaten Bauherrschaften für den freien Wohnungsmarkt erstellt, in 31 Häusern sind subventionierte Wohnungen eingerichtet.
Zu den grossen Eigentümern gehören die Anlagestiftungen der Pensimo-Gruppe mit 16 Häusern sowie die Pensionskasse BVK des Kantons Zürich und die Stiftungen HLM und HBM. Eine Plattform, der «Contrat de Quartier», animiert die Bewohnerinnen und Bewohner zur Teilnahme am öffentlichen Leben. Der Effekt zeigte sich sowohl in der Kriminalitätsstatistik als auch in der steigenden Bewohnerzahl.
Konzipiert war die Siedlung für 10 000 Personen, doch selbst zur Blütezeit wohnten hier nur gut 8000. Nach einem Rückgang auf 5500 stieg die Zahl auf gegen 7000 an, etliche davon ehemalige «enfants du Lignon» mit ihren Familien.
Die Renaissance
Im Mai 2009 erlebte die Cité satellite einen Ritterschlag, als sie der Genfer Staatsrat unter Denkmalschutz stellte. Bereits waren bei einzelnen Häusern die Holz-Metall-Fenster durch Kunststofffenster ersetzt worden. Angesichts der grossen Anzahl von Eigentümern hätte bei weitergehenden Sanierungen ein Patchwork gedroht. Die Einheitlichkeit im grossen Massstab, eines der Hauptmerkmale von Le Lignon, wäre zerstört worden.
Wie saniert man eine industriell hergestellte Fassade aus den sechziger Jahren, so dass sie nicht nur gleich aussieht, sondern auch die heutigen Wärmedämmvorschriften erfüllt? Diese Frage wurde zu einem Forschungsprojekt am Labor für Techniken und Schutz der modernen Architektur (TSAM) an der ETH Lausanne. Das oberste Prinzip: Das sanierte Lignon muss exakt so aussehen wie das nicht sanierte.
Im Forschungsprojekt von Franz Graf und Giulia Marino kristallisierten sich zwei Varianten als sinnvoll heraus: die Instandsetzung der bestehenden Fassade mit zusätzlicher Dämmung und dem Ersatz des einen Fensterglases sowie die Renovation mit dem Ersatz der ganzen Holz-Metall-Fenster und neuem Fassadenaufbau.
Die Architekten Jaccaud + Associés entwickelten eine Art Projektbaukasten, ein fachlich breit abgestütztes Komitee überwacht die Arbeiten. Ein Augenschein vor Ort zeigt, dass dieses Prinzip funktioniert: Die sanierten Teile des kilometerlangen Wohnblocks unterscheiden sich praktisch nicht von den nicht sanierten.
Mit diesem sorgfältigen Umgang mit Bausubstanz aus den sechziger Jahren kann die Cité du Lignon Vorbild für andere Ensembles dieser Zeit sein. Und angesichts der heutigen Wohnungsnot in den Städten wünscht man sich durchaus etwas von der Energie und dem Optimismus der Zeit zurück, als das Projekt für Le Lignon lanciert wurde.
Beton auf Bruchstein
Dicht gedrängt stehen die Häuser in Charrat. Der alte Dorfkern liegt am südlichen Hangfuss des Rhonetals bei Martigny, abseits der Haupt verkehrsachsen mit Autobahn, Hauptstrasse und Eisenbahn, die den Boden des Walliser Haupttals zerschneiden. Dorthin, in die Ebene hinein, sind die neueren Quartiere gewachsen.
Es gebe Walliser Gemeinden, die nur Scheussliches bewilligten, meint Architekt Valéry Clavien angesichts des architektonischen Wildwuchses. Aber manche genehmigten auch Gutes, sagt er augenzwinkernd - und er meint damit Charrat, wo er mit seinem Büropartner Nicolas Rossier ein Haus realisiert hat. Es steht beim alten Dorf, hart an der Strasse. Die Beschränkung auf wenige Elemente und ein grosses Fenster pro Fassade machen das Haus massstablos, das Sockelgeschoss aus Naturstein verankert es in der vom Rebbau geprägten Landschaft.
Vorhanden war ein schon mehrfach umgebauter und erweiterter Altbau - und ein beschränktes Budget. Deshalb haben die Architekten von der alten Substanz erhalten, was brauchbar war: die Mauern des Sockel und des halben Obergeschosses. Sie entfernten den Putz und holten das Natursteinmauerwerk hervor, auf das sie den ein bis zweigeschossigen Neubauteil aus eingefärbtem Beton setzten. Die alten Mauern blieben bis auf die Brüstungshöhe des oberen Geschosses stehen und gaben die Wandstärke vor: sechzig Zentimeter plus Dämmung - achtzig insgesamt. Um dicke, lichtfressende und wenig elegante Leibungen zu vermeiden, schnitten die Architekten ihre neuen Betonwände konisch zu und reduzierten die Zahl der Fenster auf eines pro neuem Fassadenteil.
Der Eingang liegt neu im Sockel direkt an der Strasse. Aus der Halle führt eine Treppe entlang der Bruchsteinmauer nach oben in den Wohn- und Essraum. Hinter der alten Mauer liegen die Küche und daneben ein Zimmer mit Bad. Zwei weitere Zimmer und ein Bad liegen im obersten Stock. Die Räume sind so organisiert, dass zahlreiche Wege durch das Haus entstehen, entlang der Fassaden wird es so in seiner ganzen Länge erlebbar. Auf der einen Seite schweift der Blick über die Ebene des Rhonetals, auf der anderen Seite öffnet sich das Haus gegen den sanft ansteigenden Rebhang. Das Gegenstück zu den «Lichttrichtern» der Fassade sind die «Vorhanggaragen» im Innern.
Baustein der Geschäftscity
Ein Neubau anstelle des «Grünenhofs» aus den Vierzigerjahren, Umbau und Sanierung des «Delphins» von 1912 - so stellt man sich Denkmalpflege landläufig vor. Der TU-Wettbewerb, den die UBS für die Umstrukturierung ihrer Liegenschaften am Talacker und Pelikanplatz in Zürich ausschrieb, brachte das gegenteilige Ergebnis. Das Team aus Halter GU und Stücheli Architekten überzeugte Jury und Denkmalpflege, den neueren Bau, den «Grünenhof», stehen zu lassen und den älteren, den «Delphin», abzubrechen. Die sem, einst ein stolzes Haus mit hohem Giebel an der Ecke, hatten Umbauten, insbesondere Justus Dahindens Attikageschoss aus massivem Beton, stark zugesetzt. Der «Grünenhof» hingegen, von Werner Frey in der Nachkriegszeit in Etappen erstellt, war in weiten Teilen erhalten.
Also entliess die Denkmalpflege den «Delphin» aus dem Inventar und vereinbarte mit der UBS einen Schutzvertrag für den «Grünenhof». Stücheli Architekten sanierten das Gebäude, machten es erdbebensicher, entrümpelten das Dach, rekonstruierten die Schaufenster und restaurierten die schönen Treppenhäuser. Die Büroflächen wurden modernisiert und neu eingerichtet. Anstelle des alten «Delphin» von Bollert & Herter Architekten entstand an der Ecke Talacker / St.Peter Strasse ein Neubau. Er schliesst nahtlos an die Nachbarn rechts und links an und strickt das Muster der seriellen Bürofenster weiter. An der Ecke ragt der Neubau siebengeschossig empor und setzt einen markanten Akzent - so wie es einst der Giebel des alten «Delphin» tat und es die Kuppeln des «Astoria» und des Eckhauses gegenüber noch immer tun.
Die Fassade aus Betonelementen vermittelt zwischen den Naturstein und den Putzfassaden der Nachbarn. An der Strassenfront ist der Beton sandgestrahlt veredelt, gegen den Hof - in dem übrigens Theo Hotz’ gläsernes Konferenzzentrum von 1991 steht - hingegen glatt. Die kastenartigen Fenster mit schmalen, fassadenbündigen Lüftungsflügeln verleihen der Fassade aussen wie innen Tiefe. Die Betonelemente der Fassade prägen auch die rationell möblierten Büroräume - gegen tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im «Delphin» und im «Grünenhof» ihren Arbeitsplatz. «Ein schönes Beispiel einer ansprechenden und eigenwertigen Lösung des modernen Geschäftsbaus», schrieb das «Werk» 1914 über den alten «Delphin». Dies gilt heute auch für den Neubau.
Weiche Schale, harter Kern
Das Schulhaus Eichmatt ist ein gemeinsames Werk der zwei Gemeinden Cham und Hünenberg; die Gemeindegrenze verläuft unsichtbar mitten durch das Gebäude. Das lang gestreckte, hölzerne Haus steht parallel zur Eichmattstrasse. Mit seiner kompakten Form ermöglicht es den geforderten Minergie-P-Standard, mit seiner Lage setzt es im entstehenden Wohnquartier einen starken Akzent, begründet nachträglich die Richtung der neu erstellten Strasse und betont seine Eigenständigkeit gegenüber der benachbarten Schulanlage aus den Achtzigerjahren. Geschickt nutzten die Architekten Bünzli & Courvoisier das leicht fallende Terrain aus: Gegen die Strasse, wo ein Kirschbaumhain dem Quartier als öffentlicher Ort zur Verfügung steht, ist das Volumen dreigeschossig. An der Rückseite hingegen, wo Sport- und Pausenplatz liegen, zählt es nur zwei Geschosse. Neben den Klassenzimmern und Nebenräumen der Primarschule sind darin eine Doppelturnhalle, eine Aula, drei Kindergärten, die Abwartwohnung und — organisatorisch abgetrennt — die Musikschule untergebracht.
Die gehobelte Lärchenschalung der Fassade prägt die äussere Erscheinung des Neubaus. Sie wird mit den Jahren vergrauen. Wer genau hinschaut, entdeckt hinter den Fenstern hölzerne Stützen, die nicht dem Wetter ausgesetzt sind und ihr hölzernes Antlitz behalten werden. Ein Holzhaus also? Wer in die Eingangshalle tritt, ist überrascht. Ein Boden aus geschliffenem Beton, gestrichene Wände, Gipsdecken — das Hölzerne ist weg. Einzig die Fassadenstützen aus massivem Brettschichtholz transportiert das Äussere in das Innere. Und tatsächlich ist das, was man sieht, auch das, was ist: Das Haus ist nicht ein verkleideter Holzbau, sondern ein Massivbau mit tragenden hölzernen Fassadenstützen.
Das räumliche Rückgrat des Gebäudes ist seine Erschliessung, die sich von der grossen Halle im unteren Geschoss z-förmig ins mittlere Geschoss entwickelt. Hier liegt die zum Aussenbereich orientierte Haupthalle, von der aus drei Treppen abgehen. Sie münden im obersten Stock jeweils in einen Vorbereich, den sich vier Klassenzimmer und zwei Gruppenräume teilen. Drei Höfe bringen Licht in diese Vorräume und ermöglichen vielfältige Sichtverbindungen längs und quer durchs Haus; Peter Regli hat sie je mit einer Grundfarbe künstlerisch gestaltet.
Am Bahnhof gestapelt
Die symmetrische Gestalt des historischen Winterthurer Bahnhofgebäudes täuscht: Seit je ist das eine Ende, wo die Altstadt liegt und die Bus se warten, viel belebter als das andere, wo einst die Milch aus dem Tösstal angeliefert wurde und sich die SBBAngestellten in der Milchküche verpflegten. Folgerichtig hat die Kommerzialisierung des Bahnhofs vor zehn Jahren am belebten, südlichen Teil begonnen. Dort baute Oliver Schwarz das «Stadttor» — Jahre bevor die grossen Bahnhöfe «Railcity» getauft wurden [siehe HP 4 / 01].
Als Gegenstück realisierten AGPS Architekten nun das «Stellwerk Railcity», ein Büro und Geschäftshaus mit einem Veloparking im Unter Geschoss. 160 Meter lang soll das Haus werden — falls die zweite Etappe auch realisiert wird. Vor läufig muss man sich mit der Hälfte begnügen. Drei Teile stapelten die Architekten übereinander: das Erdgeschoss mit ausladendem Vordach, das Hauptvolumen mit drei Büro geschossen und ein kürzeres zweigeschossiges Volumen, das über die eine Ecke hinausgeschoben ist. Das Motiv der Stapelung, verstärkt durch das dunkle «Fugengeschoss» des 3. Stocks, bricht die Höhe des Gebäudes und zieht es optisch in die Länge. Da nicht klar ist, wann (und ob überhaupt) die zweite Etappe realisiert wird, musste das halbe Gebäude als ganzes Haus erscheinen. So wartet zwar die geschlossene Wand auf den Weiterbau, doch die beiden auskragenden Geschosse verwischen den Brandmauercharakter. Blechpaneele in unterschiedlichen Grautönen und mit einem je nach Baukörper variierenden Rhythmus kleiden das Gebäude ein und unterstützen die Stapelung. Wie bei anderen Projekten von AGPS siehe HP 11 / 06 wurde bei der Gestaltung der Fassade die Künstlerin Blanca Blarer beigezogen. Dort, wo unter dem Vordach die Unterführung auf den Platz mündet, ist die strenge Ordnung unterbrochen: Da liess Blanca Blarer die Bleche des Vordachs «aus der Reihe tanzen» und im imaginären Fahrtwind der Züge flattern. Die Kommerzialisierung der «Railcity» Winterthur erreicht da bei weitem nicht das Mass des «Stadttors» am anderen Ende: Die Raiffeisenbank hat sich den einen, bei der Unterführung prominent gelegenen Laden gesichert, Migrolino ist in den anderen eingezogen. Für die Stadt von grösserer Bedeutung sind jedoch die Veloparkplätze im Untergeschoss, mussten dem Neubau doch zahlreiche Abstellplätze weichen, an denen viele Kantischüler ihren Drahtesel über Nacht deponierten.
Markant rationell
Das Areal liegt in der Nähe der Place des Nations in Genf. Ein Quartierplan gab vor, was darauf zu bauen ist: drei Wohnhäuser. Auf dem obersten Grundstück baute eine Stiftung für günstigen Wohnraum ein Mehrfamilienhaus mit dreissig Wohnungen à 2 bis 4 Zimmern. Mit Ausnahme der übereck orientierten Wohnungen am Südwestkopf durchstossen die Wohneinheiten das ganze Gebäude.
Die Grundrisse sind rationell organisiert, rationell ist auch die Fassade gestaltet: Es gibt zwei Fenstertypen und — mit Ausnahme der Ecken — ein Fassadenelement. Helle Betonstreifen markieren die Deckenstirnen, darauf stehen die braun eingefärbten, tragenden Betonelemente. Eine Schutzschicht verleiht ihnen einen seidenen Glanz und holt die Unregelmässigkeiten der Oberfläche hervor. Jede Wohnung hat einen grossen Balkon, deren gelbe und grüne Glasbrüstungen ein farbliches Spiel erzeugen. Das von den Architekten angedachte Wegnetz über das ganze Quartierplanareal liess sich leider nicht realisieren.
Solitär mit grosser Wirkung
Der Zylinder mit dem neuen Personalrestaurant für Nestlé zeigt, wie man eine Architekturikone erweitern kann.
Wie ein Reissverschluss reihen sich die Tabletts auf den Abräumbändern des Personalrestaurants am Nestlé-Hauptsitz in Vevey hintereinander ein. Vier Bänder fliessen zunächst paarweise zusammen, um sich schliesslich zu einem einzigen zu vereinigen und in der Abwäscherei zu verschwinden. Sensoren sorgen dafür, dass die Tabletts nicht kollidieren. Das Herz jedes Modelleisenbahners schlägt hier wohl höher. Fällt ein Band aus, laufen die verbleibenden etwas schneller, damit am Ende die Geschwindigkeit stimmt, wo flinke Hände das Geschirr im Gleichschritt des grünen Bandes in die Abwaschmaschine räumen. 1400 Mittagessen gibt das Restaurant täglich aus, da ist Effizienz auch im letzten Glied der Kette das oberste Gebot. Effizient organisiert ist auch die übrige Infrastruktur des Restaurants: Von der Anlieferung führt ein Korridor der Fassade entlang direkt zu den Lagern, den Küchen, den Liften und Treppen.
Architektur ist auch Logistik
Die Angestellten, die aus den Büros des Hauptsitzes und aus den übrigen Nestlé-Gebäuden in Vevey zur Mittagszeit in den «WellNes Centre» genannten Neubau strömen, kriegen davon nichts mit. Wer Gäste hat, nimmt im bedienten Restaurant «Le Léman » Platz, wo man gediegen tafeln kann. Die meisten jedoch schreiten die elegante Wendeltreppe empor ins Selbstbedienungsrestaurant «La Coupole». Die Treppe ist ein architektonisches Ereignis, zweifellos. Aber auch ein logistisches Element, denn sie bringt die hungrigen Nestlé-Leute mitten ins Herz des Restaurants: zum Selbstbedienungsbuffet — das gar nicht wie ein Selbstbedienungsbuffet aussieht. In einem hohen, mit einer umgestülpten Kuppel gedeckten und von einem Oblichtring belichteten Raum sind Menu- und Getränkeausgaben und Salatbuffets so grosszügig dimensioniert, dass der Ort als wirklicher «Free Flow» funktioniert.
Wer schliesslich mit beladenem Tablett die Kasse passiert, hat die Qual der Platzwahl: direkt am Fenster? Und wenn ja: mit Blick zum Park oder zum See? Oder lieber etwas erhöht mit guter Übersicht? Oder doch besser auf die Schnelle, an einem der hohen Tische? Schlechte Plätze gibt es keine; auf 270 Grad bietet die Glasfront Panoramasicht. Der Beton der kraftvollen Konstruktion, der Holzboden, die dunklen Holzeinbauten, die weisse Decke und weisse Möbel erzeugen eine lichte, angenehme Atmosphäre. Selbst an einem Januartag kommt Ferienstimmung auf, wenn die Sonne weit in den Raum hineinscheint. Die Logistiker waren besorgt, dass den Gästen der Raum so gut gefällt, dass sie zu lange sitzen bleiben. Das wäre für den Betrieb aber fatal: Es käme zum Stau, werden die Plätze pro Mittag doch bis zu dreimal belegt. Darum gibt es den Kaffee nicht hier, sondern im «Le Café» im Erdgeschoss. Dorthin gelangt man nicht über die Wendeltreppe (sie ist den hungrigen Gästen vorbehalten), sondern zwei gerade Treppenläufe führen nach unten. Diese sind — der Logistiker lässt grüssen — von je zwei Abräumbändern flankiert. So finden nicht nur die Angestellten den Weg zum Café, sondern ihre Tabletts auch den Weg in die Abwäscherei.
Der übermächtige Nachbar
Als die Architekten Richter et Dahl Rocha sich an die Arbeit machten, war zunächst der Umbau des bestehenden Restaurants geplant. Dieses lag im Erdgeschoss des «Bâtiment B», das Burckhardt Partner Architekten in den Siebzigerjahren dem Nestlé-Hauptsitz von Jean Tschumi zur Seite gestellt hatten. Doch die hohen Kosten für ein Provisorium während der Umbauzeit unterstützten den Entscheid, einen Neubau zu erstellen und das alte Restaurant in Konferenzräume umzubauen. Als Bauplatz stand das Areal zur Verfügung, auf dem einst Gustave Eiffels Villa gestanden hatte und dessen Hafen noch erhalten ist. Das leicht abfallende Terrain erlaubte es, mit wenig Aufwand die Parkplätze, die bisher fast die ganze Fläche belegten, auf zwei Geschossen zu versorgen. Damit war Platz geschaffen, um den Park am See zu erweitern und darin das Restaurant zu platzieren. Das Raumprogramm ergänzte man um ein Fitnesscenter für Angestellte und ihre Angehörigen, um einige Sitzungszimmer und eine kleine Praxis des Betriebsarztes. Die Lage am See ist prächtig, der Nachbar jedoch übermächtig: Jean Tschumis Nestlé-Hauptsitz von 1960 ist eine Ikone der Schweizer Architektur. Seine drei Gebäudearme greifen in den Raum, an deren Schnittpunkt verbindet die Doppelhelix der Wendeltreppe — benannt nach der berühmten «Escalier Chambord» im gleichnamigen Schloss in Frankreich — die Geschosse. Wie kann man Tschumis Meisterwerk erweitern? Vor 35 Jahren standen schon Burckhardt Partner Architekten vor dieser Frage. Sie setzten an das Ende des langen Y-Armes zwei weitere Gebäudeflügel. Damit wollten sie den offenen, parkartigen Hof schliessen. Das war gut gemeint, aber falsch gedacht, denn die drei Gebäudearme müssen ungehindert in die Landschaft ausgreifen können. Wie also das Ypsilon erweitern? Die Antwort ist einfach: gar nicht. Doch man kann ihm einen Solitärbau zur Seite stellen. Das hatte Tschumi selbst mit einem Hochhaus einst skizziert. So machten es auch Richter et Dahl Rocha Architectes mit ihrem Neubau: Sein Grundriss ist ein Kreis mit 50 Metern Durchmesser — solitärer geht es nicht.
Doch ganz so richtungslos, wie der Baukörper auf den ersten Blick erscheint, ist er nicht. Schliesslich hat das Grundstück unterschiedliche Qualitäten und darum kragen das Dach und die umlaufende Terrasse nicht rundherum gleich weit aus: Gegen Norden, wo die Küchen und Vorbereitungsräume liegen und die Sonne nicht scheint, ist die Auskragung klein. Gegen Süden jedoch, wo die Fensterfront im Sommer vor der warmen Sonne geschützt werden will, sind Dachvorsprung und Terrasse breiter. Geschickt haben die Architekten diese Differenz in den Stützen aufgenommen: Hinten stehen sie senkrecht, vorne sind sie nach aussen gekippt.
Das Gleichgewicht gefunden
Richter et Dahl Rocha Architectes hatten zwischen 1996 und 2000 bereits Jean Tschumis Architekturikone gründlich saniert. Dabei setzten sie sich ausführlich mit den Eigenheiten seiner Architektur auseinander. Der Geist Tschumis sollte bewahrt, wiederhergestellt oder weitergestrickt werden. Das Ergebnis ist gelungen, Tschumis Geist (wieder) spürbar — und die «Escalier Chambord» samt Linoleumbelag ist gar integral erhalten. Beim Neubau des Restaurants haben die Architekten drei Elemente bei Tschumi entlehnt: die markanten Betonstützen, die den äusseren Dachring und die inverse Kuppel tragen, das auskragende Blechdach und — als Zitat, nicht als Kopie — die Wendeltreppe, diesmal jedoch nicht als Doppelhelix. Doch Projektleiter Kenneth Ross betont: «Unser Ziel war nicht, ein Zeichen zu setzen, sondern wir wollten fortschreiben, integrieren und ergänzen. Das «WellNes Centre» ist nicht der kleine Bruder von Tschumis Gebäude, sondern ein Cousin.»
Eine luftige gläserne Passage stellt die funktionale Verbindung zu Jean Tschumis Gebäude her. Ein Wandbild, das Hans Erni 1960 für die damalige Kantine geschaffen hatte, hängt jetzt im Foyer des Neubaus und erinnert an das längst verschwundene Restaurant, das einst im Attikageschoss eingerichtet war. Der zeitgenössische Kunstbeitrag stammt von Daniel Schläpfer. In den Raum des Restaurants «La Coupole» hat er grosse Kugelkalotten gehängt, die das Nest im Nestlé-Logo symbolisieren und als indirekt beleuchtete Lampenschirme wirken. Bei der Sanierung vor zehn Jahren war der grösste Eingriff der Verbindungsbau zwischen Tschumis «Bâtiment A» und Burckhardts «Bâtiment B». Wo einst ein Schacht mit Treppen und Rampen die beiden Gebäude mit ihren unterschiedlichen Geschosshöhen aneinanderkoppelte, setzten Richter et Dahl Rocha eine lichtdurchflutete Halle mit aufgefächerten Rampen und schönem Blick auf das Hauptgebäude. Die Rampen sind auch nötig, weil bei Nestlé noch immer zweimal täglich Damen mit Chariots durch die Gänge fahren, um Kaffee und Tee zu servieren. Mit dieser neuen attraktiven Verbindung setzten die Architekten einen Gegenpol zur Wendeltreppe.
Allerdings rutschte damit das Schwergewicht des Ensembles definitiv weg von der Doppelhelix-Treppe — umso mehr, als im Erdgeschoss des «Bâtiment B» noch das Personalrestaurant untergebracht war. Das «WellNes Centre» hat die Pole erneut verschoben. Nun hat das ganze Ensemble sein Gleichgewicht gefunden. Das zeigt sich allein daran, dass die «Escalier Chambord», Jean Tschumis Prunkstück, wieder fleissig begangen wird.
Diskret, aber wirkungsvoll
Die Jury des Prix Lumière setzt die neue Beleuchtung des St. Galler Hauptbahnhofs auf Rang eins. Kunstvoll rückt sie die Halle ins beste Licht.
Bald hundert Jahre steht die Perronhalle des Bahnhofs St. Gallen nun schon an ihrem Platz, doch so brillant wie heute war sie noch nie. Helles Licht strahlt an die Hallendecke, holt die Details der Stahlkonstruktion heraus und erzeugt ein abwechslungsreiches Schattenspiel am hölzernen Unterdach. Insbesondere abends und nachts ist der prächtige Raum in seiner Grossartigkeit erlebbar. Denn ein Bahnhof ist nicht nur eine Verkehrsmaschine, sondern die Visitenkarte der Stadt. Der erste Eindruck zählt! Doch nicht allein die Decke ist ins beste Licht gerückt, auch auf den Perrons ist das Licht brilliant und einladend. Rund 250 Leuchten sind in der Halle und auf den Perrons unter freiem Himmel montiert. Sie alle sind vom gleichen Typ, doch die Charakteristiken der Ausstrahlung unterscheiden sich - je nach Aufgabe und gewünschter Lichtwirkung.
Studie stellt Weichen
Die Perronhalle wurde 1915 als Teil des zwei Jahre zuvor erbauten neuen Bahnhofs fertiggestellt. In den Neunzigerjahren erhielt sie einen neuen Anstrich, der den Kontrast zwischen der Stahlkonstruktion und der Holzschalung betonte. Die alte Hallenbeleuchtung - Bänder aus Fluoreszenzröhren - blieb damals erhalten. Doch die inzwischen vierzigjährige Anlage erreichte gerade mal ein Viertel der heute in Bahnhöfen geforderten Luxzahl. Zudem waren die Unterhaltskosten hoch und die Ersatzteile schwierig zu beschaffen. Die Durchsagen der Lautsprecheranlage waren ausserdem schlecht verständlich. Die SBB erteilten dem Architekten-Kollektiv Winterthur den Auftrag, eine Studie für eine neue Beleuchtung und Beschallung der Perrons des St. Galler Hauptbahnhofs auszuarbeiten. In dieser ersten Phase unterstützten der Innenarchitekt und Lichtplaner Kaspar Diener und der Lichtarchitekt Walter Moggio die Architekten. Das Team erkannte schnell, dass die SBB-Normbeleuchtung diesen Raum nicht in ein richtiges Licht rücken kann; die Aufgabe war anspruchsvoller. Die anfängliche Idee der Architekten, die Halle ausschliesslich indirekt zu beleuchten, musste man frühzeitig ausschliessen. Indirektes Licht konnte zwar die Hallenkonstruktion zur Geltung bringen, doch reichte es nicht, um auch auf den Perrons die geforderten Werte zu erreichen. Eher skeptisch gegenüber einer indirekten Beleuchtung waren auch die SBB, die auf den Perrons grundsätzlich direktes Licht bevorzugen.
Mit Skizzen und lichttechnischen CAD-Raummodellen entwarfen die Planer die Integration der Lichtkörper und die «Klaviatur» der Lichtführung und -wirkung. Aus den Ergebnissen dieser ersten Studie formulierten sie die Ziele der künftigen Beleuchtung: Als raumbildende Komponente und zur Verminderung des Kontrastes verfolgte man die indirekte minimale Ausleuchtung der Hallenstruktur weiter. Für eine gleichermassen angenehme wie brillante Perronausleuchtung sollte hingegen direktes, entblendetes Licht sorgen. Eine vergleichbare hohe Lichtqualität strebte man auch in den ungedeckten Bereichen der Perrons an. Ein einheitliches Standardleuchtenmodell, das mit verschiedenen Leuchtenoptiken ausgerüstet werden kann, sollte einen unterhaltsarmen Betrieb und Lichtquellenwechsel garantieren. Als Lichtquelle sollten Produkte der Energieeffizienzklasse A mit höchstmöglicher Farbwiedergabe eingesetzt werden.
Ein Werk mehrerer Disziplinen
Nach einer Ausschreibung beauftragten die SBB das Ingenieur- und Planungsbüro Ernst Basler Partner mit der Planung der Fachbereiche Licht, Ton und Elektro. Walter Moggio, Leiter der Lichtarchitektur bei Ernst Basler Partner, entwickelte die szenische Lichtführung weiter, das Architekten-Kollektiv begleitete das Projekt auf der architektonischen und gestalterischen Seite. Die neue Beleuchtung sollte nicht zu einem prägenden Element des Raumes werden, sondern sie sollte sich möglichst unauffällig darin einfügen. Die Wahl fiel auf eine robuste Leuchte aus Aluminiumguss mit einer resistenten Oberfläche, deren Farbe an die historische Halle angelehnt ist. Ein Klappmechanismus gewährleistet das einfache Auswechseln der Leuchtmittel.
Für die Befestigung der Leuchten auf einer unterhaltsfreundlichen Höhe entwarfen die Architekten ein Montageschwert. Die lichttechnischen Vorgaben und der Rhythmus der Hallenkonstruktion ergaben den maximalen Leuchtenabstand und die optimale Leuchtenanzahl. Frühzeitig band man die Denkmalpflege von SBB, Kanton und Stadt in den Prozess ein. Man bestimmte, dass siebzig Prozent des Lichtes für die Beleuchtung der Perrons sorgen und dreissig Prozent indirekt als «subjektive Raumerweiterung» an die Deckestrahlen. Mit der präzisen asymmetrischen Lichtführung wirkt sich der indirekte Anteil auf die psychologische Wahrnehmung positiv aus und unterstützt das Kontrastverhältnis.
Sehkomfort ohne Blendung
In der weiteren Planung war die Blendung eines der zentralen Themen. Insbesondere die Lokomotivführer dürfen keinesfalls von den Leuchten geblendet oder abgelenkt werden, wenn sie in den Bahnhof einfahren; die Perronkante mit den wartenden Passagieren muss in sicherem Licht erstrahlen. Die Perronbeleuchtung darf aber auch die Bahnpassagiere nicht blenden — weder jene, die auf dem Perron warten, noch jene, die bereits im Zug sitzen. Diese hohen Ansprüche an den Sehkomfort sind insbesondere mit gerichtetem Licht eine grosse Herausforderung für den Lichtarchitekten. Doch nicht nur die quantitativ messbare psychologische Blendung (gemäss der Norm SN12464-1) wurde mit einberechnet, sondern auch die Blendung, die die Sehfähigkeit beeinträchtigt — die «Nachbilder», wenn man direkt in eine helle Lichtquelle blickt. Speziell für den St. Galler Hauptbahnhof entwickelte Reflektoren und in die Leuchte eingebaute Abblendvorrichtungen garantieren die an der Perronkante geforderte mittlere kontinuierliche Beleuchtungsstärke von 180 Lux, und sie erreichen auch die verlangte hohe Entblendung.
Auf Empfehlung des Lichtarchitekten überprüfte man die Skizzen und Computerentwürfe der Beleuchtung mit einem Muster vor Ort an einem Fragment der eins zu eins aufgebauten Beleuchtung. Die Planer, Verantwortliche der SBB, Denkmalpfleger und weitere Beteiligte konnten so das Konzept «in natura» kontrollieren, wobei die Vertreter der Lokführer das Augenmerk auf die Blendung warfen.
Das Muster bestätigte, was die Simulationen versprachen; nur feine Justierungen waren notwendig. Für gut befunden wurde an der Bemusterung auch das Konzept der differenzierten Lichtfarben: neutralweiss mit bester Farbwiedergabe für das direkte Licht, ein wärmerer Farbton für das indirekte Licht, das die Decke anstrahlt. Dieses ist gegen das Glasoblicht präzise abgeschirmt, damit kein Licht direkt in den Himmel strahlt.
Die Umsetzung in Etappen
Was sich im Test am Hallenfragment bewährt hatte, musste nun noch auf die gesamte Halle und auf die Perronteile ausserhalb umgesetzt werden. Denn so regelmässig wie die Perronanlage und die Stahlkonstruktion auf den ersten Blick sind, so zahlreich sind bei genauerer Betrachtung die Ausnahmen: Das Konstruktionsraster macht Sprünge, die Perronbreiten sind unterschiedlich, und die Wartehallen - die asymmetrisch auf den Perrons stehen - dürfen Lichtniveau und Lichtkontinuität nicht beeinträchtigen.
Auf den Seitenperrons konnten die Montageschwerter an der Hallenkonstruktion befestigt werden, über dem Mittelperron sind sie an einem Kabelkanal montiert, der an einer Seilkonstruktion in die Halle gespannt ist. Für die Befestigung der ganzen Beleuchtung am historischen Bauwerk entwickelten die Architekten eine Klemmkonstruktion, die den Stahl nicht verletzt oder in seiner Tragfähigkeit einschränkt. Zudem musste gewährleistet sein, dass ein durchfahrender Zug nicht die Beleuchtung und damit die ganze Halle in gefährliche Schwingungen versetzt. Der Bahnbetrieb war zu jeder Zeit gewährleistet und sicher, die Beleuchtung während der Betriebszeiten stets garantiert. Die seitlichen Montageschwerter konnte man tagsüber befestigen, beim Hauptträger in der Hallenmitte ging man wie beim Gleisbau vor: In drei Etappen während drei Nächten demontierte man jeweils die alte Beleuchtung und Beschallung, montierte einen Abschnitt der neuen Anlage und nahm sie gleich in Betrieb. Als die ganze Halle erstmals in der neuen Beleuchtung erstrahlte, war die Freude bei den Beteiligten gross: Die Realität entspricht der Idee. Die Mühe und den planerischen Aufwand, der dafür nötig war, sieht man der Beleuchtung nicht an. Genau darum ist sie so gelungen.
Hase in Bronze
Die gebaute Aussicht
Mit einem luftigen Einfamilienhaus über Vevey hebt das junge Büro Made in aus Genf ab und setzt zum Karrieresprung an.
Wie ein Brückenträger schiesst der Fachwerkbalken ins Land hinaus — gerade so, als wolle er kein Quäntchen der prächtigen Aussicht über das Lavaux und den Genfersee verpassen und jeden Sonnenstrahl bis aufs Letzte auskosten. Wir stehen in Chardonne, einem Winzerdorf auf halber Höhe zwischen Vevey und dem Mont Pèlerin. Die Aussicht stand zuoberst auf der Prioritätenliste der Bauherrschaft. Zudem wünschte sie sich viel Garten auf dem schmalen Hanggrundstück.
Die Konstruktion
Der Skelettkasten des Hauses besteht aus zwei 21 Meter langen Vierendeelträgern, die zusammen mit den Querprofilen einen Fachwerkkasten bilden. Die Bodenplatte ist eine Verbundkonstruktion aus Stahlblech und Beton, Trapezblech spannt die Dachfläche auf. Mit Ausnahme der geschlossenen Rückwand sind alle vertikalen Öffnungen grossflächig verglast. Die horizontalen Flächen hingegen sind aussen reflektierend ausgebildet: Eine dünne Wasserschicht macht das Dach zur Spiegelfläche, eine aluminiumbedampfte Kunststofffolie haftet an der Untersicht. Die Stahlkonstruktion liegt auf der rückseitigen Betonmauer auf und führt die Querkräfte in den Boden ab. Vorne stützt sich das Haus mit zwei dünnen Ärmchen zaghaft auf dem Terrain ab — scheinbar jederzeit bereit wegzuspringen, um sich ein anderes Plätzchen am sonnigen Rebhang zu suchen.
Ein betoniertes Kellergeschoss unter dem vorderen Teil des Hauses verbindet die gespreizten Arme miteinander. Die vier Felder der in den Ecken biegesteif verbundenen Fachwerkträger definieren vier Kammern im Stahlskelett und damit die vier Haupträume des Hauses.
Am Gebäudekopf liegt das dreiseitig verglaste Wohnzimmer. Daran schliessen Küche und Esszimmer an, gefolgt vom Eingangsbereich und einem Schlafzimmer mit Bad. Im letzten Viertel gibt es ein weiteres Schlafzimmer, ein Bad und ein Arbeitszimmer. Ein Streifen mit einem Sanitär- und Technikraum bildet den Rücken.
In Natura ist das Haus kleiner, als die Fotos erwarten lassen, doch der Platz im Innern ist intelligent ausgenützt. Raumhaltige Trennwände nehmen Regale, Schränke oder ein Cheminée auf. Alles erinnert ein wenig an ein Flugzeug oder an ein Luftschiff — ein Eindruck, den die Zugangstreppe verstärkt: Wenn niemand zu Hause ist, lässt sie sich wie eine Gangway hochklappen; das Haus bleibt dann unerreichbar.
Es waren jedoch nicht Science-Fiction-Träume oder das Berufsleben des Bauherrn als Swissair-Pilot, die den Architekten beim Entwurf Pate standen. Die Architekten François Charbonnet und Patrick Heiz spitzten einfach die Wünsche der Bauherrschaft zu und setzten sie in ein radikales Projekt um. Die Funktionen, die Form und die Konstruktion des Hauses wurden eins und so stark «eingekocht» wie möglich. Dann fügten die Architekten pragmatisch die Elemente an, die es noch brauchte, etwa die Heizung: Weil sich eine dickere Bodenplatte zu stark abgezeichnet hätte, verzichteten sie auf eine unsichtbare Bodenheizung. Stattdessen setzten sie runde, lamellenförmige Heizkörper, wie wir sie aus älteren Industriegebäuden kennen, vor die Glasfronten. Bei den Lavabos und Duschen griffen die Architekten auf Modelle der Zwanzigerjahre zurück und setzen damit einen Kontrapunkt zum kantigen Haus.
Das Büro
François Charbonnet und Patrick Heiz diplomierten beide 1999 bei Hans Kollhoff an der ETH Zürich. Sind die altertümlichen Lavabos auf den Stahlgestellen kollhoffsche Reminiszenzen? Die Architekten verneinen. Nach dem Diplom schlugen sie ohnehin nicht den Weg des Historismus ein, sondern verdienten ihre Sporen bei Herzog & de Meuron ab. Charbonnet arbeitete dort als Entwerfer, unter anderem am gemeinsamen Projekt mit Rem Koolhaas für den Astor Place in New York. Heiz widmete sich hauptsächlich der Konstruktion, so als Projektleiter bei der Erweiterung des Château Petrus in Bordeaux. Vor sechs Jahren gründeten sie das Büro «Made in» — und zwar in Genf, obwohl die beiden Romands nach dem Studium in Zürich und der Praxis in Basel in der Deutschschweiz besser vernetzt sind. «Unser Deutschschweizer Hintergrund schafft eine gesunde Distanz zur Westschweizer Szene», meint François Charbonnet, schiebt aber nach, dass es eine starke Westschweizer Szene eigentlich gar nicht gebe: «In der Deutschschweiz passiert einfach mehr. Das gibt uns die Gelegenheit, hier etwas zu sagen.»
Von sich reden machten die beiden bislang vor allem mit ihren Wettbewerbsprojekten, die das Spektrum ihres Schaffens zeigen. 2005 machte das junge Büro erstmals ein breites Publikum auf sich aufmerksam, als es in dem vom BSA organisierten Wettbewerb «Genève 2020» den zweiten Preis errang siehe hpw 5 / 05. Der Entwurf für das Château Cheval Blanc im französischen Saint-Émilion von 2006 wirkt wie ein Prototyp des Hauses in Chardonne im grösseren Massstab: Mit Vierendeelträgern entwerfen sie dort einen schwebenden eingeschossigen Stahl-Glas-Bau, der auch Erinnerungen an das Werk Ludwig Mies van der Rohes weckt. Ganz anders der Beitrag im Wettbewerb für eine Wohnüberbauung in Lausanne siehe hpw 4 / 09, wo sie die Zimmer aller Wohnungen kurzerhand entlang der maximal möglichen Mantellinie des Hauses aufreihten. Damit erzeugten sie einen Baublock mit einem Innenhof, dessen Form sich aus der Abwicklung der unterschiedlichen Zimmergrössen ergibt.
Die Bauherrschaft
Das in die Landschaft ragende Haus in den Rebbergen von Chardonne ist nicht das erste Objekt, das Made in realisieren konnte. Es ist aber das erste Gebäude, das die Überlegungen der beiden Architekten im Massstab eins zu eins zeigt. Gute Architektur braucht gute Bauherren — an solch einzigartigen Lagen erst recht. Dass sie bei diesem Entwurf weitgehend freie Hand hatten, ist einem einfachen Umstand zu verdanken: Patrick Heiz ist der Sohn der Bauherren. Sie wollten den beiden jungen Architekten die Möglichkeit bieten, ihre Ideen und ihr Können, das sie in Projekten und Wettbewerben schon zeigen konnten, auch an einem gebauten Objekt zu demonstrieren.
Zuvor wohnten Heidi und Samuel Heiz 35 Jahre lang in einem Bauernhaus. «Wenn schon ein Wechsel, dann richtig», fanden sie. Radikaler könnte der Wechsel kaum sein. Doch die Möbel aus dem alten Haus fanden auch im neuen Platz. Das mag das Puristenauge schmerzen, die Architektur hat keine Berührungsängste. Die Anforderungen, die die Bauherrschaft am Anfang zu Papier brachte, sind erfüllt: Der Garten ist gross, die Aussicht grandios inszeniert. Doch das Haus ist nicht nur ein Schönwetterhaus, wie die Bauherrin versichert: Ebenso faszinierend wie der sonnige Blick sei das Spiel von Wind, Wetter und Nebel.
Die einzigartige Mischung aus Lage und Architektur hat dem Gebäude und dem Schaffen von Made in Auftritte in zahlreichen Publikationen beschert. Der Paukenschlag wurde gehört — auch von der Jury des Wettbewerbs für die Erweiterung des Kunsthauses Basel: Made in ist eines von 24 Teams, die Ende September ihren Entwurf einreichten. Der Juryentscheid lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor, aber allein die Tatsache, dass es sich mit Koryphäen wie Peter Zumthor, Tadao Ando, Zaha Hadid und etlichen anderen messen darf, dürfte die Karriere von François Charbonnet und Patrick Heiz beflügeln.
Zahlen, Noten und Krawatten
Der Ecoparc Neuenburg ist zu einem vielfältigen Bahnhofquartier angewachsen – dank dem Grosseinsatz der Bauart Architekten.
Eine Musikschule an der Bahnlinie? Die Skepsis war gross, als Bauart Architekten dem Kanton Neuenburg vorschlugen, das Konservatorium im geplanten Neubau beim Bahnhof unterzubringen. Auch der Vorschlag, unter dem gleichen Dach die Hochschule für Wirtschaft einzuquartieren, war nicht nahe liegend. Doch das Projekt hatte zwei Vorteile: die verkehrsmässig ausgezeichnete Lage und die schnelle Verfügbarkeit. Die anfängliche Skepsis ist spätestens mit der Eröffnung des Neubaus Mitte Mai 2009 verflogen. «Die Studenten brauchten etwas Zeit, um sich an diese Kohabitation zu gewöhnen», blickt Emmanuel Rey von Bauart Architekten auf die ersten Tage zurück. Heute geben die angehenden Musiker den krawattierten Businessleuten gerne eine spontane Kostprobe ihres Könnens.
Musik und Wirtschaft
Dass unter einem Dach Musik und Wirtschaft gelehrt wird, merken Aussenstehende an den unterschiedlichen Farben der Raumbezeichnungen. Gemeinsam sind der Eingang, die Cafeteria und das grosse Auditorium. Gemeinsam ist auch das organisatorische Dach: die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO). Allerdings gehört die Hochschule für Wirtschaft zur Hochschule Arc (Neuenburg, Bern, Jura), die professionelle Musikerausbildung hingegen ist eine Antenne der Genfer Haute Ecole de Musique. Unabhängig davon bietet das Konservatorium Neuenburg hier eine nicht professionelle Musikausbildung an.
Seine Hauptfront richtet der Neubau gegen den Espace de l’Europe. Der vom Landschaftsarchitekturbüro Paysagestion gestaltete öffentliche Raum, oszillierend zwischen Strasse und Platz, zieht sich vom Bahnhof dem Gebäude des Bundesamts für Statistik entlang und weitet sich im hinteren Bereich zu einem Platz. Vier zweigeschossige schwarze Kuben, die auf unterschiedlichen Höhen weit in den Platz hinausstossen, bilden den Blickfang der Doppelschule. Darin sind die grossen Volumen untergebracht: Auditorium, Mehrzwecksaal, Rhythmiksaal, Cafeteria. Verankert sind diese Black Boxes an einem viergeschossigen Rücken an der Bahnlinie. In ihm sind die übrigen Räume beidseitig eines langen Korridors aufgereiht. Vier doppelgeschossige Hallen, die «Espaces transparents», durchstossen den Baukörper und rhythmisieren den langen Gang. Baurechtlich sind sie eine Konzession an die durchgehende Viergeschossigkeit des Hauses, architektonisch sind sie mehr: Sie öffnen den Blick auf die Stadt und lassen die Stadt am Innenleben teilhaben. Die in leuchtendem Gelbgrün gestrichenen, beidseitig verglasten Hallen sind Treffpunkte und Kommunikationsorte. Im Gegensatz zur knalligen Farbe der «Espaces transparents » und der Korridore steht das Innere der schwarzen Kisten. Hier erzeugt ein mehrschichtiger Anstrich einen metallischen Effekt.
Seit zwanzig Jahren am Werk
Der Neubau des Konservatoriums und der Hochschule für Wirtschaft ist ein weiterer Baustein des Quartiers Ecoparc in Crêt-Taconnet, einer urbanen Brache beim Bahnhof Neuenburg. In einem Zeitraum von zwanzig Jahren schufen hier die Architekten von Bauart einen Stadtteil, der unterschiedliche Nutzungen in vielfältigen Gebäuden vereint — und dies erst noch auf ökologisch sinnvolle Art.
Der Startschuss fiel 1990 mit dem Wettbewerb für das Bundesamt für Statistik (BfS), das von Bern nach Neuenburg übersiedeln sollte.
Die Architekten hatten einen engeren Wettbewerbsund einen weiteren Ideenperimeter zu bearbeiten. Bauart Architekten übersetzten die geforderte hohe Dichte in grosse Gebäude und setzten ein Langhaus und ein Turmhaus. 1998 war das Langhaus des BfS vollendet und hob Neuenburg auf die Karte der zeitgenössischen Architektur. Imposant waren nicht nur die Dimensionen, eindrücklich war auch seine ökologische Bauweise siehe HP 10 / 98. Wobei diese gar nicht von Anfang an so umfassend eingeplant war, wie Emmanuel Rey betont: Erst während der Planung wurde das Thema ein konkretes Ziel für Bauart Architekten und die Bauherrschaft.
Beim 2004 vollendeten BfS-Hochhaus siehe HP 3 / 04 war die Nachhaltigkeit von Anfang an Programm.
Gelegenheit gepackt
Schon bald nach dem Wettbewerb waren Bauart Architekten mehr als Architekten. Sie witterten die Chance, der Planung des Gebiets Crêt-Taconnet zusätzlichen Schwung zu verleihen, umso mehr, als die Stadt zu jener Zeit einen neuen Zonenplan und eine neue Bauordnung entwickelte. Bauart kontaktierte die vier Besitzer des Areals — die SBB, einen Baumaterialunternehmer und zwei Private — und überzeugte sie davon, dass die neue Bauordnung eine gute Gelegenheit ist, um ein gemeinsames Projekt zu entwickeln. Die Architekten erhielten das Mandat, einen Quartierplan zu erarbeiten, den Kontakt mit der Stadt zu suchen und das Gebiet zu vermarkten. In der Folge flossen die Elemente des Wettbewerbs in die städtische Planung ein und das Gebiet wurde zum wichtigsten der drei Entwicklungsschwerpunkte Neuenburgs.
Die Architekten überzeugten die Eigentümer davon, die Grenzen vorerst ausser Acht zu lassen. «Wir lassen die Parzellengrenzen beiseite und machen das Beste für den Ort», erklärt Rey die Devise.
Als das Quartier auf dem Plan fertig war, legte Bauart die Grenzen so, dass alle Grundstücke in etwa gleichwertig waren. Rechtskräftig wurden die Grenzen indes etappenweise im Takt der Wandlung des Quartiers. Dieses fand seine Gestalt gemäss drei Prinzipien. Erstens: Die grösste Dichte gibt es auf dem Plateau mit den hohen Objekten an der Geländekante. Zweitens: Die Objekte unterhalb des Plateaus sind kleiner, Altbauten bleiben wo möglich bestehen und nehmen den Massstab des Quartiers auf. Drittens: Entlang der Gleise kommt «ein langer Schlitten» zu stehen. Nutzungsmässig gab der Quartierplan wenig vor; er wollte die Räumlichkeit bewahren und die Entwicklungsmöglichkeiten offen halten. Definiert war ein Anteil von mindestens vierzig Prozent Wohnen; realisiert hat man mehr.
Ein Labor für die nachhaltigkeit
Das «Experiment Nachhaltigkeit», das Bauart mit dem Bundesamt für Statistik begann, floss auch ins Gesamtprojekt ein. Dafür konstituierte sich eine rund 15-köpfige Gruppe aus Stadt, Kanton, Bund, SBB, ETH Lausanne, Universität Neuenburg, Vertretern von Bauart und weiteren Interessierten. Die Gruppe schrieb nicht vor, was zu tun ist, sondern sie verstand sich als Laboratorium auf der Suche nach Lösungen. Aus der Gruppe wurde 2000 der Verein Ecoparc. Er hat sich die Förderung der Nachhaltigkeit über den Ecoparc und über Neuenburg hinaus auf die Fahnen geschrieben. Über 250 Personen besuchen jeweils die Biennale «Forum Ecoparc» in der Uni Neuenburg. Ging die Planung mit den vier Grundeigentümern bis zur Baureife im Jahr 2000 noch flott voran, so harzte es zunächst mit der Vermarktung. Crêt-Taconnet war noch eine öde Brache, keine attraktive Adresse. Interesse war zwar vorhanden — von der Helvetia Versicherung für die Wohnbauten, vom Kanton allenfalls für die beiden Schulen. Bloss fehlte die Initialzündung. Da beschloss Bauart, ein Haus selbst zu kaufen und zu einem Lofthaus aus- und umzubauen. Das gab den entscheidenden Kick. «Wenn die Architekten hier selbst investieren, dann müssen sie wohl von ihrem Projekt überzeugt sein», mutmasst Emmanuel Rey über die Beweggründe von Helvetia, zwei Wohnhäuser zu erstellen. Später übernahm die Versicherung auch die beiden anderen, während eine Villa in private Hände ging und Bauart einen Altbau für ihr Neuenburger Büro übernahm.
Und noch eine Schule
Dank der erfolgreichen Entwicklung des östlichen Teils des Plateaus hatten auch die SBB das Potenzial des Standorts erkannt und Bauart mit dem Vorprojekt für den Neubau TransEurope auf dem schmalen Landstreifen zwischen BfS-Langhaus und Gleisen beauftragt, wo die Architekten einen 285 Meter langen Riegel planten. Mit zwei weiteren Abteilungen der Haute Ecole Arc wurde eine Mieterin gefunden, die eine eindrückliche Dynamik in den Planungsprozess brachte: Innerhalb eines Jahres planten die Architekten das Büro- und Geschäftshaus zu einem Schulhaus um, erstellten den Kostenvoranschlag, reichten die Baueingabe ein — und begannen mit dem Bau. Dieser erste Teil der letzten Etappe des Quartiers Ecoparc wird bis 2011 fertig gestellt. Vier Jahre später wollen die SBB den zweiten Teil realisieren und damit das Quartier vollenden.
Das Zeug zum symbolträchtigen Schlussstein von Ecoparc hat jedoch eine andere Initiative von Bauart: die Passerelle in der Verlängerung des Espace de l’Europe, die den Bahnhof mit den Gebäuden der Wissenschaftlichen Fakultät der Universität verbindet. «Passerelle du Millénaire» könnte sie heissen, die Finanzierung wird zurzeit aufgegleist. 2011, zum 1000-Jahr-Jubiläum der Stadt Neuenburg, soll die Brücke stehen.
Jedem seine Wohnung
Eng umschlungen von den Gleisen der Sihltalbahn, der Sihl samt Hochstrasse und der stark befahrenen Giesshübelstrasse lag der östliche Teil des Giesshübelquartiers in Zürich lange Zeit abseits grosser städtebaulicher Umwälzungen. Das war einmal. Beflügelt von der exzellenten Verkehrserschliessung und auch vom nahen Einkaufszentrum Sihlcity wird das Gewerbeviertel immer mehr zur Wohnadresse.
Mittendrin sitzt Edeneins, eine Überbauung aus zwei Häusern mit insgesamt 61 Eigentumswohnungen. Die beiden Baukörper stehen direkt an der Strasse und spannen so die ganze Grundstücksfläche auf. In der Mitte liegt der gemeinschaftliche Hof, der dank den leicht geknickten Fassaden räumlich gefasst ist und die beiden Teile von Edeneins zu einer Einheit verbindet. Die Setzung der Bauten direkt an die Trottoirkante nimmt das im Quartier typische Muster auf und unterstreicht den städtischen Charakter der Neubauten. Die identischen, hier gegeneinander leicht versetzten grossen Fensterformate setzen die beiden neuen Häuser in Beziehung zu den älteren Gewerbehäusern.
Im Innern der kraftvollen Grossformen verbergen sich unterschiedliche Wohnungstypen von 52 bis 220 Quadratmetern: konventionelle Grundrisse, Maisonettes, Lofts und Wohnateliers. Allen Wohnungen gemeinsam ist ihr Bezug sowohl zur Strasse als auch zum Hof. Ein meist frei stehender Kern besetzt die Mitte jeder Wohnung und nimmt Küchen, Sanitärzellen und Nebenräume auf. Weitere Wände hatten die Architekten zwar nicht vorgegeben, aber als Möglichkeit vorgesehen. Sie konfektionierten jede Wohnung nach den Wünschen der Eigentümer — von der grosszügigen Einraumwohnung bis zur kleinformatigen Zimmeraufteilung.
Besonders raffiniert sind die Maisonettewohnungen im Erdgeschoss, die auf der einen Seite direkt aufs Trottoir blicken: An einer Stelle entstand in einer durchgehenden zweigeschossigen Raumscheibe mit eingestellter Treppe ein städtischer Raum innerhalb der Wohnung.
Darin kann man sich vor Einblicken schützen, ohne von der Aussenwelt abgeschottet zu sein.
Die Transformation des Quartiers geht weiter: Gleich gegenüber von Edeneins klafft eine Lücke, wo bis vor Kurzem noch ein Gewerbehaus stand, und einen Steinwurf entfernt entsteht Edendrei, ein weiterer Neubau der gleichen Architekten, ebenfalls mit Eigentumswohnungen.
Der Berner Bär erweitert seinen Horizont
Bern, die gemächliche Beamtenstadt? Das war einmal. Eindrückliche Neubauten zeigen eine Dynamik, die die Bundesstadt zu einem Ziel für Architekturtouristen macht.
Paris ist der Eiffelturm, London der Big Ben, New York die Skyline. Und Bern? Bern ist die Altstadt in der Aareschlaufe. Von keiner anderen Schweizer Stadt machen wir uns ein so klares Bild. Selbst Bern Tourismus hat die Aareschlaufe in ihr Logo aufgenommen. Einzigartig und prächtig ist das Unesco-Weltkulturerbe — aber ist es nicht auch etwas langweilig, etwas gar gemütlich? Tatsächlich scheint in der Berner Altstadt, die auch Einkaufs- und Geschäftsstadt ist, kaum je Hektik aufzukommen. Nicht einmal an den Samstagen vor Weihnachten, wenn die ganze Stadt samt Agglomeration am «Rohren» ist, die Lauben rauf- und runterströmt. Liegt das am sprichwörtlichen Berner Charakter? Vielleicht. Doch selbst ungestüme Zürcher werden hier schnell gebremst: Platz zum Überholen gibt es in den engen Lauben nicht; die Gemächlichen geben das Tempo vor. Ganz anders geht es am Bahnhof zu und her, dem einzigen Ort, wo Bern Grossstadt ist. Hier, am Ende der Spitalgasse, ist das Ventil, an dem der Druck der geschäftigen Altstadtgassen Richtung Westen entweicht — und sogleich verpufft.
Denn wenn Bernerinnen und Berner «Stadt» sagen, dann meinen sie die Altstadt, und wenn sie dort einkaufen gehen, bewegen sie sich zwischen Bahnhofplatz und Zytglogge. Selbst durchaus städtische Quartiere, wie die Länggasse oberhalb des Bahnhofs oder der Breitenrain jenseits der Kornhausbrücke, gelten in der Berner Wahrnehmung nicht wirklich als Stadt. Auch aus der «Länggyge» oder dem «Breitsch» geht man «in die Stadt» und meint damit die Altstadt. Wohnen tun hier allerdings keine 4000 Seelen mehr.
Der Blick weitet sich
Zwei Neubauten haben in den letzten Jahren den Blick aus der Altstadt an den Stadtrand gelenkt: das «Zentrum Paul Klee» siehe HP 8 / 05 und das Freizeit- und Einkaufszentrum «Westside» siehe HP 1–2 / 09. Dieses ist der Magnet des neuen Stadtteils Brünnen, in dem Wohnraum für 2600 Bernerinnen und Berner entsteht, ein Stück Stadt mit klar definierten Strassen- und Platzräumen und mit Projekten aus unterschiedlichen Büros, erstellt für unterschiedliche Bauträger. Die ersten Konturen kann man heute besichtigen, doch für eine Bilanz ist es noch zu früh. Die Neubauten brauchen Zeit, um mit ihrer Umgebung zu verwachsen. Neue Ausrufezeichen stehen auch im Zentrum, die jüngsten sind eben erst fertig geworden: der Bärenpark, der am 25. Oktober eingeweiht wird, und der Annexbau des Historischen Museums siehe Seite 24. Zahlreiche neu gestaltete Strassen und Plätze — Bundesplatz, Casinoplatz, Bahnhofplatz — geben Orte, die einst vom Auto beherrscht waren, den Menschen zurück. Man mag sich darüber streiten, ob das Kleezentrum an der Autobahn draussen wirklich am richtigen Ort steht und ob «Westside» trotz idealem Bahn-, Bus- und bald auch Tramanschluss eben nicht doch mehr Autoverkehr erzeugt. Beiden ist es jedoch innerhalb kurzer Zeit gelungen, den Horizont der Stadt beträchtlich zu erweitern — nicht nur bei den Auswärtigen, sondern auch bei den Einheimischen. Huldigt das eine der Kultur, frönt das andere dem Kommerz, beides sind Architekturikonen geworden. Sie stehen nicht allein. Mehr über das «neue Bern» gibts in Hochparterres Architekturführer «Bern baut», der ab Ende Oktober im Buchhandel erhältlich ist. Rund 130 000 Menschen wohnen in der Stadt Bern.
Ihnen stehen 150 000 Arbeitsplätze gegenüber. «Das bedeutet nicht nur den Verkehr von täglich 70 000 Zupendlern, sondern auch hohe Belastungen für Berns Rolle als Zentrum, denen keine entsprechenden Steuereinnahmen gegenüber stehen », unterstreicht Regula Buchmüller, die Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung. Die Stadt will dieses Verhältnis ändern und strebt eine Einwohnerzahl von 140 000 an — 1962 lag sie noch bei 165 768. Seit den Neunzigerjahren steht der Wohnungsbau zuoberst auf der Prioritätenliste der Stadtentwicklung. In eigener Regie kann die Stadt nur wenig bauen. Als der alte Staat Bern 1852 unter dem Kanton, der Stadt und der Burgergemeinde aufgeteilt wurde, erhielt die Stadt vor allem die Bauten, die Burgergemeinde hingegen das Land. Diese tritt denn auch bei etlichen Projekten als Baurechtsgeberin auf.
Mehr Genossenschaftsbauten
Untervertreten ist in Bern der gemeinnützige Wohnungsbau. Im «roten Zürich» und im «roten Biel» förderten die sozialdemokratischen Mehrheiten in den Zwanziger- und Dreissigerjahren den kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsbau. Ein «rotes Bern» gab es damals nicht. Heute ist immerhin ein Drittel der Wohnungen, die in den letzten acht Jahren entstanden, genossenschaftlich. Der Turnaround bei der Bevölkerungsentwicklung ist jedenfalls gelungen. Nach fast vierzig Jahren Rückgang ist die Einwohnerzahl seit Anfang des Jahrzehnts fast jedes Jahr gestiegen.
Genial oder banal?
Das neue Schulhaus Leutschenbach spaltet die Architekturkritiker. Sechs kontroverse Meinungen zum Bau von Christian Kerez.
Es ist das zweitgrösste Schulhaus der Stadt Zürich und von der Kindergärtlerin bis zum Sekschüler gehen hier alle ein und aus. Der Bau dauerte ein Jahr länger als vorgesehen. Die Erscheinung ist für ein Schulhaus so ungewöhnlich, dass sie polarisieren muss. Seit August ist das Schulhaus Leutschenbach nun in Betrieb und Hochparterres Redaktorinnen und Redaktoren besichtigten es mit dem Architekten Christian Kerez.
Die Heiligsprechung des Banalen
Ivo Bösch: Die Jury traute dem Entwurf von Christian Kerez nicht zu, dass er baubar ist. Im Wettbewerb aus dem Jahr 2003 liess sie zwei Projekte überarbeiten. Zwar gefielen damals die Zonen zwischen den Schulzimmern. Doch dieser Bereich war Fluchtweg, also nicht nutzbar. Erst nach der Überarbeitung schlug Kerez die Fluchtbalkone vor. Der Feuerpolizist entwarf also beträchtlich mit. Eine Turnhalle auf dem Dach, eine Doppeltreppe, aneinander gereihte, hohe Schulzimmer und eine stützenfreie Fassade im Erdgeschoss: Mehr steckt nicht im Entwurf. Der Kern des Projekts ist die Konstruktion.
Das Haus steht nur auf sechs Dreifachstützen. Für den Handstand auf dem kleinen Finger scheute der Architekt keine Kosten. Doch bestimmte der Bauingenieur, wo welche Querschnitte welche Lasten tragen. Was Kerez mit dem kompakten Entwurf gewinnt, verliert er mit dieser Konstruktion. Obwohl beim Ausbau gespart wurde und obwohl es die zweitgrösste Schule der Stadt Zürich ist, ist der Bau im Kubikmetervergleich (BKP 1– 9: CHF 1108.–/m3, Stand August 2009) eines der teuersten Schulhäuser. Schon die Jury schrieb nach der ersten Stufe: «Die durch die kompakte Gebäudeform gegebene Ausgangslage für eine günstige Ökonomie wird durch zu erwartende erhöhte konstruktive Aufwendungen gemindert.» Dass diese Aufwendungen so gross werden und der Ausbau so leiden musste, konnte sie nicht voraussehen: Wände aus Industrieglas, in den Schulgeschossen Kunststeinplatten am Boden, sichtbare PE-Abwasserleitungen. Alles wirkt banal, Kerez würde es reduziert nennen. Glück für ihn, dass das Schulhaus in Schwamendingen steht und die Stadt endlich ein Signal für die Quartierentwicklung neben der Kehrichtverbrennungsanlage setzen musste.
Alles schrumpft
Roderick Hönig: 1994 stellte Pipilotti Rist im Kunstmuseum St. Gallen zwei überdimensionale Fernsehsessel neben eine meterhohe Stehlampe. Wer versuchte, die gigantischen, kaum handhabbaren Möbel zu besteigen, lernte physisch seine Lektion in Raumwahrnehmung. Die drei ungewöhnlich hohen Klassenzimmergeschosse erinnern an Rists Installation. Nur ists im Schulhaus Leutschenbach umgekehrt: Die Räume sind überdurchschnittlich hoch — satte 3,6 Meter, das Minimum schreibt 3 Meter vor. Die Überhöhe verleiht weiten Atem und Grosszügigkeit und lässt, wie in Rists Arbeit, Schülerin und Lehrer auf Kindergrösse «schrumpfen ». Die Architektur stellt so die Machtverhältnisse im Schulhaus in Frage, sie demokratisiert Subjekt und Objekt. Kerez sichert mit seinen überhohen Klassenzimmern und Pausenhallen aber auch die Souveränität seines Werks. Die Überhöhe sorgt dafür, dass Möblierung und Raum kaum in ein Verhältnis treten und dass man nicht plötzlich vor lauter Schulmöbel und farbigem Kinderleben Kerez’ «architecture brut» nicht mehr sieht. Elegant ist, dass der eitle Wunsch nach Wahrung der Reinheit der eigenen Architektur nicht auf Kosten der Nutzer geht — im Gegenteil: Die überdurchschnittliche Raumhöhe ist die Attraktion und Qualität des Schulhauses. Der Luxus, bezahlt auf Kosten des Ausbaus.
Die Paulista-Schule
Axel Simon: Wo ist da die Angemessenheit? Und was ist mit den hohen Kosten? Spätere Erweiterungsmöglichkeiten? Es gibt Bauwerke, an denen perlen solche Fragen ab. Radikalität imprägniert sie zum Manifest. In Leutschenbach steht man vor einem solchen, schaut einfach nur, blöd vor Staunen. Hier liegt Zürich nicht in der Schweiz, sondern am Rande São Paulos. Sicher, Kerez’ Konstruktionen sind komplizierter als diejenigen von Artigas, Bo Bardi oder Mendes da Rocha, die hiesigen Anforderungen sind es sowieso. Die räumliche Idee jedoch ist ähnlich: eine weite Landschaft rundum, die sich im Inneren widerspiegelt, sowie ein Raum, der mit zunehmender Schwere des Hauses an Leichtigkeit gewinnt. Die eidgenössische Komplexität der scheinbar einfachen Struktur überspielt der Architekt, indem er sich jede Oberflächengüte versagt. Der sichtbaren Stapelung der Etagen entsprechen der sichtbar gegossene Beton, der sichtbar geschweisste Stahl, das sichtbar gefügte Gussglas. Die Rohheit des Materials und der immense Raum machen aus der Schule eine Werkstatt, einen Ort, an dem man ohne die Bürde des Perfekten schaffen, sich ausbreiten, auf dem Trottinette durchjagen kann. Keine gebeugten Rücken, keine Schulkrüppel! Diese Forderung, die der spätere Bauhausdirektor Hannes Meyer 1926 seinem konstruktivistischen Petersschul-Entwurf beilegte, könnte auch auf den Leutschenbacher Beton gesprüht stehen — als Kunst am Bau versteht sich.
Ein starkes Stück
Werner Huber: Wie ein Equilibrist steht das Schulhaus auf der Wiese am Rand von Leutschenbach, scheint unter Hochspannung zu sein. Es berührt den Boden kaum, die Tragstruktur balanciert die Lasten der aufeinandergetürmten Nutzungen ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Die gleiche Spannung ist im Innern zu spüren, auch wenn die Fachwerkträger nicht immer zu sehen sind und es nicht auf Anhieb klar ist, wie die Statik überhaupt funktioniert. Kräfte werden über Umwege spazieren geführt, bevor sie den Boden erreichen. Es wäre einfacher gegangen. Ein paar Stützen hier und da diskret platziert — wer würde den Unterschied schon sehen? Kaum jemand, doch spüren würde man ihn bestimmt.
Der Architekt ist seinen Weg konsequent gegangen und hat alles seinem Konzept untergeordnet. Das ist seine grosse Leistung. Die Betonoberflächen sind nicht perfekt, der Ausbau ist karg, konstruktive Ausnahmen gibt es zuhauf. An irgendeinem anderen Bau würde man das beklagen, hier ist das sekundär. Kerez hat die richtigen Prioritäten gesetzt. Nur im Erdgeschoss musste das Konzept vor der Nutzung zurücktreten — und prompt ist
es daneben geraten: Nie und nimmer dürfte es verglast sein.
Republikanisch geschärft
Benedikt Loderer: Zwei Gründe, warum ich das Schulhaus Leutschenbach gut finde: Es ist republikanisch und es ist geschärft. In Schwamendingen leben viele jener Leute, denen man eine bildungsferne Herkunft nachsagt und die ihre Kinder nicht vor allem zum Lernen anstacheln. Für sie baute die Stadt Zürich ein republikanisches Schulhaus. Es ist ein Versprechen. Nie, sagt die Stadt, werden wir vom Prinzip der allgemeinen und obligatorischen Volksschule abweichen. Wir wollen weder Kloster-, noch Koran- oder Eliteschulen. Vor der Schule ist jedes Kind gleich und wir geben keines auf. Wir bilden sie zu Zürchern. Wir bauen Integrationsschulen. Dort, wo die Kinder am schwierigsten sind, machen wir nicht weniger, sondern mehr. Wir sparen nicht an den Bedürftigen. Gut genug gibt es nicht, wo es ein Mehr braucht. Das Schulhaus repräsentiert den Bildungsanspruch der Stadt. Dieses republikanische Schul- und Selbstverständnis strahlt das neue Schulhaus aus. Das Konzept ist einfach: Kerez stapelt. Er setzt die Nutzungen nicht neben-, sondern schichtet sie übereinander. Den Rest des Grundstücks lässt er frei. Das Konzept überzeugte im Wettbewerb, doch dann begann die Arbeit. Es nahm die Hürden der Feuerpolizei, bewältigte das gerade geltende pädagogische Programm, überwand die Schwierigkeiten seiner eigenen Statik, besiegte den Kostendruck, kurz, es wurde verwirklicht.
Selbstverständlich sieht es heute anders aus als im Wettbewerb — aber nicht verwässert, sondern geschärft. Kerez ist einer der wenigen Architekten, die Konzessionen machen können, ohne Schaden an ihrem architektonischen Konzept zu nehmen. Er ist nicht stur, er ist nur konsequent. Er weiss: Wer alles verteidigt, verteidigt nichts. Und er weiss, was er aufgeben kann, um das zu behalten, was er unbedingt haben will. Selektives Wichtignehmen heisst diese Schärfungskunst. Kerez ist ein Meister darin.
Die Konsequenzen der Konsequenz
Rahel Marti: Christian Kerez will konsequente Architektur schaffen. Er kämpft für die Reinheit der einen, einfachen Idee. Offenbar gelang es ihm, die Beteiligten für diese heroische Haltung zu gewinnen. Kerez stapelt, der Park soll frei bleiben. Er baut Glaswände, dazwischen soll Raum zum Lernen entstehen. Er will ein klares und rohes Schulhaus, in dem sich Schülerinnen und Lehrer entfalten. Paradoxerweise braucht es dafür ein komplexes Tragwerk und Bauarbeiten, die ein Jahr länger dauerten als geplant. Was aussieht wie eine strukturalistische Höchstleistung, ist eine Reihung von Ausnahmen und Kompromissen. Um etwa den Park ins Haus fliessen zu lassen — und dies bildlich, denn in der Tat gibt es ja eine Glasfassade —, ist das Gebäude an einer komplexen Fachwerkkonstruktion aufgehängt. Um die Reinheit dieser statischen Idee zu belassen, nimmt der Architekt verschiedenste Fachwerkdimensionen und damit verschiedenste Deckenfelder in Kauf, was zu zahllosen konstruktiven Anpassungen führt. Um den freien Grundriss in den Treppenhallen zu ermöglichen, sind breite, umlaufende Fluchtbalkone nötig. Damit hier keine Kinder herumrennen, werden sich Lehrerinnen und Lehrer Regeln ausdenken müssen. Um die Transluzenz des Industrieglases nicht zu stören, sind an den Wänden der Schulzimmer und der Turngarderoben nicht metallene Kleiderhaken montiert, sondern kleine, ab - bruchgefährdete Plastikhaken aufgeklebt. Die Konsequenz reicht soweit, dass Kerez auch Massnahmen durchsetzt, die mit pädagogischen Zielen nichts mehr zu tun haben. Etwa, dass keine Leuchten, dass nichts von den hohen Decken hängen darf, was aufwändige Betoneinlegearbeiten erforderte. Man wird sehen, denn nun muss sich das aussergewöhnliche Schulhaus bewähren. Sonst war die reine Idee architektonischer Selbstzweck und der Preis dafür hoch.
Fünfzig Jahre Verkehrsmuseum
Zum Jubiläum schenkt sich das Museum in Luzern einen Umbau. Das Architekturbüro Gigon / Guyer verhilft zu neuem Glanz.
Wann waren Sie zum letzten Mal im Verkehrshaus in Luzern? Als Kind vor Jahrzehnten mit Ihren Eltern oder auf der Schulreise? Erinnern Sie sich an das starre Rössli vor dem Tram, an die aufgeschnittenen SBB-Waggons und die Coronado im Hof? Vielleicht waren Sie auch erst vor wenigen Jahren dort, mit Ihren Kindern oder gar Enkeln. Dann ist bestimmt das wohlige «Weisch-no»-Gefühl heraufgekrochen und hat die alten Erinnerungen an frühere Ausflüge geweckt. Als Architektin oder Architekt haben Sie dann auch die Gebäude betrachtet, den Fünfziger- oder Siebzigerjahre-Charme begutachtet und gedacht: Hier müsste man wieder mal etwas machen!
Jetzt, pünktlich zu seinem fünfzigsten Geburtstag, hat das Verkehrshaus etwas gemacht: Zwei neue Häuser — FutureCom und Halle Strassenverkehr — und in der Mitte eine grosse Leere: die Arena. Die Neubauten gehen auf den Wettbewerb zurück, mit dem das Verkehrshaus vor zehn Jahren ein Entwicklungskonzept bis 2020 und einen Entwurf für eine neue Strassenverkehrshalle suchte. Das Zürcher Architekturbüro Gigon / Guyer schuf eine grosse, vielfältig nutzbare Freifläche im Zentrum des Museumskomplexes und gewann damit den Wettbewerb. Über Jahre, während denen das Museum seine strukturellen Probleme löste, passierte nichts; erst 2005 erhielten Gigon / Guyer den Auftrag — nicht nur für die Halle Strassenverkehr, wie in der ersten Etappe beabsichtigt, sondern auch für den neuen Eingang.
5000 glänzende Räder
Das Eingangsgebäude empfängt schon seit vergangenem November die Besucherinnen und Besucher des Verkehrshauses. Blickfang ist die Profilglas-Fassade, hinter der über 5000 Räder aller Art die Mobilität symbolisieren. Hauptsächlich prangt hier Altmetall in Form von Autofelgen, dazwischen eingestreut sind aber auch Holzräder, Schiffsschrauben, Steuer- und Transmissionsräder, die hinter der Glasmembran im Sonnenlicht glänzen. Einzelne Fensteröffnungen durchbrechen die Fassade und gewähren einen Blick ins Haus. Im Erdgeschoss öffnet eine Glasfront das Haus fast auf der ganzen Breite und gewährt den Blick quer durch die Halle. Auf einer grossen Fläche sind hier alle Funktionen angeordnet, die ein Museum braucht: Foyer, Kasse, Informationsstand und natürlich der grosse Shop. Direkt an die Eingangshalle angeschlossen sind auch die Halle Schienenverkehr, das IMAX-Kino und die beiden Restaurants, das bediente «Piccard» und das «Mercato» mit Selbstbedienung, das seine beiden gläsernen Finger weit in den Hof hinausstreckt.
In der Eingangshalle lenkt eine grosse Deckenöffnung den Blick nach oben, und eine Rolltreppe animiert zur Fahrt in den 1. Stock. Hier ist die Media-Factory untergebracht, einer der neuen ausstellerischen Höhepunkte des Verkehrshauses, der dem ganzen Eingangsgebäude auch den unglücklichen Namen «FutureCom» verliehen hat. Die Ausstellung thematisiert an elf Stationen die Welt der modernen Kommunikation. Insbesondere die Kinder sind fasziniert vom Fernsehstudio, in dem sie in originaler Umgebung mit echter Technik Beiträge und Sendeabläufe gestalten können. Die Architektur spielt hier kaum mehr eine Rolle; verlangt war eine beliebig bespielbare schwarze Kiste. Immerhin konnten die Architekten zwei Fenster in die Fassade schneiden. Davon ist eines zwar abgedeckt, kann jedoch problemlos geöffnet werden, wenn sich die Museumslandschaft dereinst von der Blackbox verabschiedet. Viel Platz nimmt in diesem Geschoss die Haustechnik ein, eine Folge des Budgets und des Hochwassers von 2005. Im zweiten Obergeschoss des FutureCom-Gebäudes ist das Konferenzzentrum mit einem fünfhundertplätzigen Saal und drei Sitzungszimmern untergebracht. Hier gewähren grosse Glasflächen den Blick aus dem Foyer ins Museumsgelände und auf den See. So konnten die Architekten die Verkehrshausatmosphäre ins Haus holen, ohne den Raum mit Versatzstücken von Autos, Eisenbahnen oder Flugzeugen dekorieren zu müssen.
344 bunte Tafeln
Bereits aus der neuen Eingangshalle ist der zweite Neubau auf dem Museumsgelände zu sehen: die Halle für Strassenverkehr. Blaue Verkehrsschilder, die schon bei wenig Licht hell leuchten, ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Unweigerlich beginnt man zu lesen: «Grenchen, Arch, Büren a. A.», «Bellinzona Sud, Locarno, Polizia», «Tuggen 1000 m»; Ortsnamen aus der ganzen Schweiz geben sich hier ein Stelldichein. An der rechten Fassade sind die Tafeln grün wie auf der Autobahn, und die weissen Schilder der Nebenstrassen bekleiden die linke Fassade. Die Schilder an der Rückseite des Hauses sind verkehrt herum aufgehängt, die Nachbarn schauen also von hinten auf die Tafeln. Mit diesen Fassaden reagierten Gigon / Guyer auf den Wunsch der Ausstellungsmacher nach einer Blackbox.
Das Wettbewerbsprojekt von 1999 war nämlich noch ein grosszügig verglastes Gebäude aus Wandscheiben und aussen liegenden Rampen, bei dem innen und aussen eng ineinander verzahnt waren.
Der Schilder-Schild ist eine originelle Lösung für die «dekorierte Kiste», ohne dem Sauglattismus zu verfallen. Bei Venturis «Learning von Las Vegas» haben wir gelernt, wie der Autoverkehr — oder vielmehr die auf das schnelle Auto ausgerichtete Beschilderung — die Architektur beeinflusst. Noch stimmiger wäre das Bild, wenn man (wie ursprünglich beabsichtigt) hier auch Altmetall, nämlich gebrauchte Tafeln montiert hätte, die dann nicht nur Fassade, sondern auch Ausstellungsgut wären. Jetzt sind es jedoch Duplikate von bestehenden Schildern. «Falsch» sind einzelne Schilder wie jenes für die Route 66 oder der Wegweiser nach Moskau, Kiew und Murmansk oder das Beton-Schild, das auf die Konstruktion verweist.
Im Innern ist die Strassenverkehrshalle zweigeschossig und flexibel nutzbar. Fix eingebaut als starker Rücken des Hauses ist die Hauptattraktion: ein Hochregallager, das die ganze Längsseite einnimmt und auf 42 Paletten über 80 Zeitzeugen zeigt — von der Kutsche übers Velo bis zum Auto. Im Autotheater gleich nebenan wählen die Besucher ihr Lieblingsgefährt aus, das der Parkierroboter dann aus dem Regal holt und auf der Drehscheibe des Theaters zur genauen Betrachtung abstellt. Mehrere Themeninseln sind weiteren Aspekten des Strassenverkehrs gewidmet und in einem Schauatelier können die Besucher verfolgen, wie das Verkehrshaus seine Fahrzeuge konserviert und restauriert.
Auch in dieser Halle zieht sich die Architektur gegenüber der Ausstellung in den dunklen Hintergrund zurück. Sie ist die neutrale Hülle, die jeden be-liebigen Inhalt zulässt — «architektonische Instrumente», auf denen irgendwelche «Melodien» gespielt werden können, wie es Annette Gigon ausdrückt. Jeglicher Bezug nach aussen fehlt, denn auch sind die beiden Fenster weitgehend zugeklebt und werden es wohl auch bleiben. Wer in der Halle ist, blendet das übrige Verkehrshaus zwangsläufig aus.
Ein grosser Platz
So eindrücklich die beiden Neubauten auch sind — die Halle Strassenverkehr gar mit Ikonenpotenzial —, die grösste Überraschung im neuen Verkehrshaus bereitet die grosse Leere in dessen Mitte. Woher kam plötzlich dieser Platz? Ganz einfach: Die Gebäude von 1959 mussten weichen. Nun erinnert einzig der alte Teil der Abteilung Schienenverkehr an die heiteren Bauten und den idyllischen Gartenhof des ersten Verkehrshaus-Architekten Otto Dreyer. Man mag diesen Verlust bedauern, sollte dabei aber die Gewinnseite beachten.
Mit der Öffnung der Anlage gehören jetzt auch Gebäude, die bislang etwas peripher lagen, zum Ensemble, etwa die Hallen Luftverkehr und Schifffahrt aus den Siebzigerjahren von Hans Ulrich Gübelin. Stolz weisen der frisch lackierte Coronado-Jet und das Dampfschiff Rigi auf ihre Abteilungen. Im grossen Hof bildet ein flaches Wasserbecken die Zäsur zwischen dem öffentlichen Bereich und dem Museum; das Eintrittsbillett ist der Brückenzoll. Etwas im Abseits scheint einzig die Halle Schienenverkehr von Uli Huber zu stehen, obschon sie eine ganze Platzseite besetzt. Doch die davor im Freien ausgestellten Waggons sind nicht gerade die Prachtstücke der Sammlung, ausserdem besetzen der Verkehrsgarten und die Strassenbauarena den Vorplatz des Schienenverkehrs. Die beiden bei den Kindern beliebten Einrichtungen und auch die Steuerpulte der Modellschiffe und die Lastwagenfahranlage erscheinen wie zufällige Ablagerungen auf der leeren Bühne der Arena. Es hätte der Arena an dieser Flanke gut getan, wenn diese wohl dauerhaften Spielgeräte in einen gestalterischen Rahmen eingebunden wären, dies umso mehr, als nun die spielenden Kinder der Sonne ausgesetzt sind. Die Idee, Baumtröge wie an der Expo.02 mit Rädern auszustatten, war eine reizvolle Idee, die sich jedoch nicht verwirklichen liess — mehr als eine Saison hätten die Gehölze kaum überlebt. Nun muss man sich in den Schatten der Flugzeuge und temporären Installationen zurückziehen.
Nutzen wird das Verkehrshaus die Arena als Ort für Sonderausstellungen und Veranstaltungen, ohne die ein Museum heute kaum mehr funktionieren kann. Die grosse Betonplatte in der Mitte bietet dazu alle Möglichkeiten. Über einen Fahrweg durch die Eingangshalle gelangt auch der beliebte Oldtimercorso in die Arena. Zu seinem fünfzigsten Geburtstag hat das Verkehrshaus die Voraussetzungen dafür geschaffen, auch weiterhin das meistbesuchte Museum der Schweiz zu bleiben. Es ist jetzt nicht nur eine Verkehrs-, sondern auch eine Architekturdestination.
Gleichberechtigte Partner
Dreieinfamilienhaus
Das Grundstück am Ende der Sackgasse, dort wo das Einfamilienhausquartier in die Landwirtschaftszone übergeht, bot Platz für drei Wohnungen. Reihenhäuser? So ist das eingeklemmte Mittelhaus benachteiligt. Geschosswohnungen? So hat die mittlere Wohnung weder Garten noch Dachterrasse. Daher entwickelten die m3 Architekten aus Zürich ein sternförmig organisiertes Dreieinfamilienhaus. Darin ist jeder Teil gleichberechtigt, hat einen Garten und eine Dachterrasse mit Blick ins Glattal. Die drei Wohneinheiten sind bis auf die Ausrichtung identisch, stehen mit dem Rücken zueinander und bilden dort den spannendsten Raum des Dreizacks: den Lichthof über der gemeinsamen Eingangshalle. Wer das Haus von aussen betrachtet, versteht auf Anhieb nicht, wie es funktioniert. Die drei Teile sind nicht sofort zu erkennen, denn die einheitliche Farbe, die Einschnitte im Attikageschoss und das Spiel mit Fensterformaten verwischen die Eigentumsgrenzen. In jedem der drei Hausteile gibt es auf drei Geschossen 7 ½ Zimmer — und die sind intensiv genutzt: Neun Kinder sind hier daheim.
Bildung im Klinkerkleid
Dem Careum ist ein starker Auftritt gelungen. Die Mauern bieten der Schule mehr Platz und verleihen dem Platte-Quartier einen neuen Charakter.
Die Platte, eine Geländestufe am Zürichberg, ist seit Langem ein Brennpunkt des Gesundheitswesens und der Architektur. Das jüngste Familienmitglied ist der Careum Campus, eine Überbauung von GWJ Architekten mit dem Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe und Wohnungen. Dort wo die Platte in den Hang übergeht, stehen fünf kantige, in Klinker gehüllte Kuben. Die Hauptrolle spielt das Schulgebäude an der Ecke Gloria- / Pestalozzistrasse, das mit einem «Schaufenster» in die Stadt blickt. Dahinter ragt eine höher gestellte Hausscheibe mit weiteren Schul- und Laborräumen empor. Diese spannt mit dem Haupthaus einen Winkel auf und umschliesst den dreieckigen Platz, den eine Sandsteinklippe von Piero Maspoli gegen die Strasse abschliesst. Drei weitere Gebäude stehen im hinteren Teil des Areals; im einen gibt es Büros in den Sockel- und Wohnungen in den Obergeschossen, die beiden anderen sind Wohnhäuser.
Harte Hülle
GWJ Architekten haben den Careum Campus als ein Stück Stadt komponiert. Die fünf Häuser vermitteln zwischen dem grossen Massstab des Spital- und Hochschulquartiers mit dem Zahnärztlichen Institut und dem Schwesternhochhaus in der unmittelbaren Nachbarschaft und der kleinmassstäblichen Bebauung des Zürichbergs. Die Architekten nutzten das abfallende Gelände, um Höfe und Terrassen zu bilden, die Landschaftsarchitekten Klötzli und Friedli haben diese Aussenräume gestaltet.
Wer durch die Höfe und Gassen spaziert, begibt sich auf eine Promenade architecturale; zwischen den Neubauten hindurch öffnen sich Blicke auf die anderen Bauten des Campus, auf die stolzen Villen des Zürichbergs oder auf die Grossbauten der Sechzigerjahre. Die verschiedenartig gemauerten Klinkersteine verbinden die unterschiedlich genutzten Gebäude zu einem Ensemble: An den Sockelbereichen, an den Deckenstirnen und den Stützmauern bilden Läuferverbände homogene Flächen, in den Geschossen ist jede zweite Läuferschicht zurückgesetzt, sodass eine starke horizontale Zeichnung entsteht, die entweder als geschlossene Wand oder als lichtdurchlässiges Gitter ausgeführt ist.
Im Wechsel der Tages- und Jahreszeiten changieren die Fassaden in unterschiedlichen Farben, nicht nur dank dem lebendigen Material, sondern auch dank dem Relief, das wie ein präzises Ornament über den Gebäuden liegt. Der Klinker ist als Material so dominant, dass man erst auf den zweiten Blick die unterschiedlich gros-sen, aber immer geschosshohen Öffnungen registriert — Fensterbänder an den Schulgebäuden, Lochfenster an den Wohnhäusern.
Weicher Kern
Das Herzstück des Hauptgebäudes ist die sogenannte «Kommunikations- und Bildungslandschaft» mit Bibliothek, Cafe-teria und Studierhof im Erd- und Sockelgeschoss. In den Obergeschossen sind die vielfältig nutz- und umnutzbaren Unterrichtsräume untergebracht. Dazu gehören die «Skillslabs», originalgetreu nachgebildete Krankenzimmer und Operationsräume, in denen die künftigen Pflegefachfrauen und -männer üben können — zum Teil an Schauspielerpatienten. Das Gebäude erinnert weniger an ein Schulhaus, bei dem die pädagogischen Anforderungen in Beton gegossen oder in Stein gemauert sind, sondern eher an ein Bürogebäude. Wer an die Trennwände klopft, stellt fest: Leichtbau! Die Raumaufteilung ist eine Momentaufnahme der aktuellen Bedürfnisse. Wandeln sich diese, bricht man die Wände mit wenig Aufwand ab und zieht sie an anderer Stelle neu ein.
Massiv und unverrückbar ist das Gebäude hingegen in seinem Kern. Treppenturm und Lichthof verbinden die «Bildungslandschaft» der unteren mit den Unterrichtsräumen der oberen Geschosse. Urs Eberles kräftige farbliche Gestaltung dieser beiden Räume unterstreicht die Bedeutung dieser Vertikalen als Orte der Kommunikation.
Das Erbe des Pfarrers
So neu die Gebäude und so modern der Name, so alt ist die Tradition, die hinter dem Careum steht. Im Jahr 1880 regte Pfarrer Walter Bion an, eine Anstalt zu gründen, an der Krankenpflegerinnen frei von religiöser Propaganda ausgebildet werden können. 1882 nahm sie ihre Arbeit auf und wurde bald zur Stiftung. Die Ausbildung war immer das wichtigste Standbein, obschon das angegliederte Rotkreuzspital in der Öffentlichkeit bekannter war. Als in den Neunzigerjahren die Belegung stark zurückging, prüfte die Stiftung Kooperationen mit anderen Privatspitälern. Diese waren aber nicht realisierbar, auch wegen des Vetos der kantonalen Gesundheitsdirektion, die Akutbetten und Kosten reduzieren wollte.
Schliesslich beschloss die Stiftung, das Rotkreuzspital Ende September 1997 zu schliessen. «Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende», meinte Stiftungspräsident Arnold Saxer.
Die Neuausrichtung zielte auf die Erhaltung der Bildung in den Gesundheitsberufen. Dafür wurde eine neu konzipierte Berufsschule für Pflege geplant. Neben der Schule sollten aber auch Wohnungen des mittleren und oberen Segments entstehen. Dies, um den gesetzlichen Wohnanteil von vierzig Prozent zu erfüllen, aber auch als Immobilienanlage, deren Erträge wieder in den Stiftungszweck investiert werden.
Zwei Workshops mit der Stadt Zürich bildeten die Basis für die Planung. Ende 1999 lud die Stiftung fünf Architektenteams zu einem begleiteten Studienauftrag ein. «Begleitet» heisst, dass die Architekten während des Verfahrens ihre Skizzen und Entwürfe in zwei Workshops vorstellten.
Nicht hinter verschlossenen Türen planen
Die erste Veranstaltung fand im Februar 2000 statt. Das Tagesziel waren eine Auslegeordnung der städtebaulichen und planerischen Strategie sowie das Verhältnis zwischen Alt- und Neubauten. Während des ganzen Tages waren auch sämtliche Wettbewerbsteams anwesend. Am Abend wusste also nicht nur die Stiftung, in welche Richtung die einzelnen Teams arbeiteten, sondern auch die Konkurrenten waren gegenseitig über ihre Konzepte orientiert.
Im zweiten Workshop im Mai 2000 stellten die Teams ihre Projekte unter Ausschluss ihrer Konkurrenten vor. «Erhärtung der Projektstrukturen» lautete das Tagesziel. Die letzte Runde des Studienauftrags endete mit der Abgabe der fünf Projekte im Sommer 2000 und dem Entscheid des Beurteilungsgremiums.
Mark Werren von GWJ Architekten erinnerten die Workshops an die Zwischenkritiken zu Studienzeiten: «Dieses Verfahren hat uns motiviert. Wir lernten die Bauherrschaft kennen und verstanden, welche Programmpunkte noch offen sind.» Damals war in der angestrebten neuen Art der Ausbildung noch nicht alles definiert und die Stiftung gewann die Erkenntnis, dass sie das Projekt allenfalls etappieren oder einzelne Bauten erhalten will — was schliesslich ein wichtiger Punkt für die Wahl von GWJ Architekten war. Als einziges skizzierte ihr Projekt die Verwirklichung in zwei voneinander unabhängigen, städtebaulich überzeugenden Etappen.
Neue Schule fürs neue Haus
Parallel zu den Planungen am neuen Haus arbeitete die «Stiftung Schwesternschule und Krankenhaus vom Roten Kreuz in Zürich-Fluntern», wie sie immer noch hiess, an den neuen Ausbildungsgängen. Der Kanton wollte seinerseits die 26 bestehenden Ausbildungsstätten für Gesundheitsberufe auf zwei reduzieren, in Winterthur und in Zürich. Mit der neuen Ausbildung und dem neuen Haus, das bereits im Bau war, stand die Stiftung für diese Aufgabe bereit. Die Bemühungen haben sich gelohnt: Anfang 2005 wurde mit dem Kanton Zürich die Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Zusammen mit den drei Partnern Kalaidos, Neumünster und Eleonorenstiftung wurde das «Careum Bildungszentrum, Zürich» gegründet. Damit waren die Voraussetzungen für den Start der zweiten Bauetappe gegeben.
Für die Gebäude, die nicht vom eigenen Bildungszentrum benötigt werden, wurden weitere Mieter gesucht, die dem Stiftungszweck entsprechen. So zogen die Medizinbibliothek der Universität und des Universitätsspitals, das Dekanat und das Studiendekanat der Medizinischen Fakultät ins Haus. Dazu gesellten sich weitere Institutionen aus dem Gesundheits- und Bildungsbereich. Doch auch die Stiftung Careum expandierte, gründete einen Verlag oder ein Fachportal im Internet.
Das erste Jahr unter Vollbetrieb ist abgeschlossen; gegen 2000 Studierende beleben den Campus — zur Zufriedenheit aller, wie Stiftungsrat René Kühne unterstreicht: «Die Reaktionen der Schülerinnen und der Bewohner sind positiv. Das hat nicht zuletzt mit der Architektur zu tun.»
Mit Ecken und Kanten
Wohn- und Geschäftshaus St.-Jakob-Turm
Gedrungen steht der grünlich schimmernde St.-Jakob-Turm zwischen dem Stadion St.-Jakob und dem Flüsschen Birs. Auf einen Blick ist seine Form kaum zu erfassen. Vielwinklig im Grund- und Aufriss ragt er samt Sockel 19-geschossig in die Höhe. Doch weil die obersten 10 Geschosse spitz zulaufen, sieht man dem Turm seine Höhe nicht an, und wenn man genug nahe steht, fällt die obere Hälfte gänzlich aus dem Sichtfeld. Ein Hochhaus, das sich klein macht? Wendet man den Blick aufs Ganze, erklärt sich der Turm fast von selbst — als Schlusspunkt und Ausrufezeichen in der Silhouette des St.-Jakob-Parks.
Der Sockelbau mit der Eventplattform auf dem Dach und dem Autohaus in der Ecke schliesst nahtlos ans Bestehende an und im Untergeschoss dockt der Neubau an das Einkaufszentrum und vervollständigt die Mall zu einem Rundgang. Die Schrägen und die schiefen Ebenen, die das St.-Jakob-Stadion und die angegliederte Altersresidenz prägen, haben die Architekten weitergestrickt und am Turm in die Höhe gefaltet.
Gegen die Bahnlinie in seinem Rücken überzieht eine geschlossene Glasfassade aus raumhohen Elementen den Turm. Hier — gegen Norden — sind Büroräume und Dienstleistungsflächen angeordnet. Richtung Süden wird die Fassade zu einer raumhaltigen Schicht. Die grünlich schimmernden Gläser verjüngen sich zu Brüstungs- und Schürzenelementen vor einem schmalen Loggiastreifen. Konventionelle Holzfenster mit Rafflamellenstoren bilden hier die Klimagrenze und weisen auf die dahinter liegende Nutzung hin: Wohnen. Insgesamt gibt es in dieser besser besonnten Turmhälfte zwischen dem 5. und dem 17. Stock 37 Wohnungen von 2 ½ bis 5 ½ Zimmern. Die vier obersten Geschosse sind vollständig dem Wohnen vorbehalten.
Wie die Gesamtform fügt sich auch die Detaillierung des St.-Jakob-Turms ins Stadionensemble ein: Was aus der Ferne als filigrane Glashaut erscheint, entpuppt sich aus der Nähe als robuste Konstruktion, die zudem so weit vom Boden abgehoben ist, dass sie kaum vom rauen Treiben der Fussballfans tangiert ist; der Turmfuss schafft hier Distanz.