
WienerBerg Dojo
Wien (A) - 2003
mit Michael Loudon, Walter Hans Michl
Architekturzentrum Wien
Studium der Architektur an der ETH; Baupraxis. 1977-85 Assistent bei Prof. A.M.Vogt und Doktorat in Architekturgeschichte an der ETH Zürich. Lebte seit 1985 in Wien und arbeitete auf dem Gebiet der Architektur als Entwerfer, Historiker, Kritiker, Kurator und Austellungsmacher.
Seit 1989 gemeinsames Atelier mit Architekt Walter Hans Michl in Wien: Möbeldesign, Bau- und Wettbewerbsprojekte, Wettbewerbsorganisationen, Juryteilnahmen, städtebauliche Konzepte.
Bauten: Stadthaus in Wien-Neubau, Kirchenzentrum St.Benedikt in Wien-Simmering. Konzept und wissenschaftliche Leitung für die Steirische Landesausstellung 1995, „Holzzeit“ und Initiierung der „Murauer Werkstätten“ (mit Franziska Ullmann, Wien).
Buchpublikationen u.a. über Adolf Krischanitz, Gustav Peichl, Boris Podrecca. Regelmäßige Architekturkritik im Spectrum (Die Presse, Wien) sowie Beiträge in Fachzeitschriften und Ausstellungskatalogen.
Man sieht den Kräfteverlauf, spürt den Lasten nach, staunt über die Eleganz der Unterseiten: die Brücken des Bauingenieurs Alfred Pauser.
Was haben die Brücken am Knoten Nussdorf, die Gürtelbrücke, die U6-Brücke, der Siemens-Nixdorf-Steg, die Rossauerbrücke, die Salztorbrücke, der Erdberger Steg, die Erdberger Brücke, die Schrägseilbrücke, alle über den Donaukanal, gemeinsam? Sie sind Entwürfe des Bauingenieurs Alfred Pauser; der erste noch im Ingenieurbüro Dr. Wycital, die späteren in eigener Verantwortung. Es sind Brücken mit unterschiedlichen Tragwerken, alle in ihrer Art durchaus elegant und formschön. Zahlreiche weitere Brücken aus dem Büro Pauser befinden sich auf Wiener Stadtgebiet, weitere über ganz Österreich verteilt. Sie belegen die Kompetenz ihres Entwerfers und seiner Büropartner.
Es mag zwar mittlerweile nicht mehr allgemein verbreiteter Irrglaube sein, dass der Bauingenieur nur genau zu rechnen brauche und sich die Form des Bauwerks quasi automatisch ergebe. Nicht zuletzt Le Corbusier verbreitete in seinem „Vers une achitecture“ diesen Unsinn. Nein, der Bauingenieur entwirft auf der Basis seiner Kompetenz und seiner Erfahrung ein Brückentragwerk, ein Silo, einen Turm, die er dann exakt berechnet. Denn ins Leere lässt sich nicht rechnen. Das heißt nichts anderes, als dass die Arbeit des Bauingenieurs sehr wohl kreativ ist, auch wenn das Feld möglicher Lösungen nicht unbegrenzt ist. Allerdings ist die Ästhetik von Ingenieurbauwerken nicht nur eine optische, sondern die innere Struktur, das Tragkonzept spielen eine ebenso wichtige Rolle. Die ästhetischen Vorstellungen unterscheiden sich daher von jenen, wie sie in der Architektur verbreitet sind.
Glücklicherweise verfügte Alfred Pauser, abgesehen von seiner enormen Schaffenskraft, über gestalterische Fähigkeiten, die er dank seiner konstruktiven Kenntnisse und Erfahrungen optimal einsetzen konnte. Seine Brücken weisen plastische Qualitäten auf und sind von unten sowohl interessant anzuschauen als auch konstruktiv nachvollziehbar und ordentlich aufgeräumt. Einbauten und Leitungen werden nicht dem Zufall überlassen. Dies lässt sie besonders im urbanen Raum als Teile der Stadtlandschaft nicht bloß für die Benützer, sondern ebenso für Flaneure attraktiv werden.
Beginnen wir mit der Rossauer Brücke, 1981–83. Die ingenieurmäßige Beschreibung liest sich, trotz der engen Randbedingungen, wie wenn es so sein müsste. Aber auf diese Stringenz muss man als entwerfender Bauingenieur zuerst kommen. Ein Rahmenträger von Kai zu Kai besteht in den Randfeldern aus massiven Tischen, die je auf vierfach gespreizten Streben auflagern, die ihrerseits in ein kräftiges Punktlager münden. Das Mittelfeld aus vorgefertigten Spannbetonträgern ist biegesteif in den Rahmen integriert. Für Einbauten und Leitungen ist in der Mittelachse eine entsprechende Aussparung vorgesehen. Das Tragwerk ist logisch, gewiss ökonomisch, aber es weist für den technisch kaum gebildeten Betrachter ebenso optische Qualitäten auf. Man sieht den Kräfteverlauf, spürt den Lasten nach, staunt über die Eleganz der Streben und die Größe der Punktlager. Insbesondere die Unterseite zeugt von plastischer Kraft, welche die nächtliche Effektbeleuchtung durchaus rechtfertigt.
Die Brücken im Knoten Nussdorf, 1974–83, mussten auf sehr engem Raum unter den für Schnellstraßen strengeren Trassierungsrichtlinien geplant werden. Aus meiner Sicht weisen die weiten Räume unter der Hochstraße eine spezielle Qualität auf. Wenn man die Pfeiler und Brückenträger als Teil der Stadtlandschaft an dieser dichten Stelle der Peripherie zu sehen bereit ist, ergibt sich plötzlich eine neue, spannungsvolle Raumstimmung. Auch hier ist der eigentlichen Sichtseite, der Unterseite, einiges an Sorgfalt beigemessen. Man merkt, es handelt sich nicht nur um einen beliebigen Zweckbau, vielmehr war von Anfang an die Ahnung da, dass der Raum unter der Brücke den Menschen als Weg und sogar dem Aufenthalt dienen würde. Gewiss sind diese Räume offen und fließend, aber das zeichnet die Moderne aus. Und ihre Aneignung kann durchaus kultivierter erfolgen als durch Hinterlassung individueller Markierungen.
Ein Bauwerk, das wegen der zunehmenden Verkehrsdichte bereits ersetzt werden musste, ist die erste Praterhochstraße von 1970. Die eleganten X-Stützen und auch die Fahrbahnkonstruktion bestanden sämtlich aus vorgefertigten Betonelementen. In der Auenlandschaft fügte sich die Brücke mit ihrer Leichtigkeit gut ein und fiel dem sensiblen Auge immer wieder positiv auf.
Eine Besonderheit ist die Erdberger Brücke im Zuge der A 23, 1969–71. Diese in ihrer Form erstmalige Schalenkonstruktion bildet im Stadtgefüge einen Akzent, der den Rang des Verkehrswegs als Autobahn und der Brückenstelle interpretiert. Als Bauwerk schafft die Brücke einen unverwechselbaren Ort in der Stadt, der nicht vordringlich den Benutzern, sondern Spaziergängern und Radfahrern als Merkpunkt dient.
Ein Kabinettstück der Vorspanntechnik ist der Franz-von-Sales-Steg, 1967–68, an der Osttangente. Die äußerst elegante Konstruktion stützt sich auf einen Pfeiler, um den sich der Wendel des Gehwegs herumschwingt. Das andere, höhere Widerlager wird vom ausgreifenden, kontinuierlich in der Stärke abnehmenden Brückenarm kaum mehr belastet. Es ist klar, dass derart anspruchsvolle Konstruktionen bei einem Fußgängersteg eher möglich sind. Dennoch zeigt sich an diesem Beispiel sowohl der kreative Freiraum, den sich der begabte Bauingenieur aufzuspannen vermag, als auch die plastische Kraft, die dem Objekt innewohnt.
Alfred Pauser stammt aus dem niederösterreichischen Gmünd, wo er 1930 geboren wurde; übrigens zeitgleich mit der Gruppe der Holzmeister-Schüler Wilhelm Holzbauer, Friedrich Kurrent und Friedrich Achleitner und anderen, die später Einfluss auf die Wiener Architektur nahmen. Mit Wilhelm Holzbauer hat Alfred Pauser oft zusammengearbeitet. Er studierte ab 1948 an der Technischen Hochschule Wien, war schon bald als Werkstudent im Ingenieurbüro von Dr. Wycital tätig und wurde 1962 Partner. Früh hatte er die Chance, mit dem großen Bauingenieur Fritz Leonhardt zusammenzuarbeiten, der mit dem Bau der Schwedenbrücke befasst war. Dies öffnete ihm nicht nur den internationalen fachlichen Austausch, sondern führte zu einer lebenslangen Freundschaft. 1964 gründete er sein eigenes Ingenieurbüro, das er ab 1979 mit den langjährigen Mitarbeitern Karl Beschorner, Peter Biberschick und Hans Klenovec in Partnerschaft führte. 1982 wurde er als Ordinarius für Hochbau an die Technische Universität Wien berufen, wo er sich nicht zuletzt für eine Verbesserung der Beziehung von Architektur- und Bauingenieurstudenten einsetzte. 1997 emeritiert, zog er sich 2002 auch aus dem Büroverbund zurück. Zahlreiche allgemein verständliche Publikationen zum Brückenbau zeugen von seinem breiten Wissen. Die erstmalige Verleihung des Wiener Ingenieurpreises ist neben den zahlreichen Auszeichnungen für sein Werk ein gewichtiger Impuls für den Ingenieurberuf ganz allgemein.
Brettsperrholz aus Sicht der Planer
Anlässlich der großen Holzausstellung »Holzzeit« 1995 im steirischen Murau kam buchstäblich in letzter Sekunde noch ein Pavillon aus einem damals gänzlich neuen Produkt dazu: aus Brettsperrholz, BSP. Der Eindruck war durchaus positiv, doch gelang es dem neuartigen Angebot im Kontext der thematisch breit angelegten Ausstellung nicht, sich schon in den Köpfen der Fachleute zu verankern. Heute, mehr als ein Jahrzehnt später und unter veränderten klimatischen und holzwirtschaftlichen Bedingungen, ist das Material durchaus bekannt. Erfahrene Fachleute räumen ihm in einer gezielten Befragung gute Chancen für die Zukunft ein. Die Architekten Hubert Rieß, Johannes Kaufmann und Gerhard Mitterberger sowie der Bauingenieur Gordian Kley von merz kley partner antworteten auf der Basis ihrer mehrjährigen Erfahrung mit dem Produkt.
Die Anwendungsmöglichkeiten von BSP sind sehr breit. Wenn das Gewicht entscheidend ist, etwa bei schlechtem Baugrund oder bei Aufstockungen, ist es unabhängig von der Nutzung ein Mittel der Wahl (Rieß). Die bauphysikalischen Kennwerte und die klare Trennung Rohbau / Ausbau erlauben eine einfache und sichere Planung (Rieß).
»BSP eignet sich besonders gut im mehrgeschossigen Wohnungs- und Verwaltungsbau, weil es hoch tragfähig ist und gute bauphysikalische und brandtechnische Werte hat.« (Kley)
Beim Konstruieren liegen die Vorteile in der Größe der Elemente. Es sind einfache, puristische Konstruktionen möglich (Kley) und nicht jeder Akteur muss ein »Akrobat« sein, um damit umzugehen (Kaufmann). Im Vordergrund steht natürlich eine Bauweise auf der Basis eines großmaschigen Konstruktionsrasters, damit Verschnitt und Kosten gespart werden. Bei kleineren Bauwerken, die formal exquisiter sein sollen, lässt sich jedoch sehr wohl eine Konfektion einzelner Teile auf Maß denken, die, kraftschlüssig zusammengefügt, interessante Formbildungen erlauben.
»Mit der zur Verfügung stehenden Abbundsoftware ist ‚Maßkonfektion’ selbstverständlich möglich.« (Rieß)
In gewissen Grenzen lässt sich mit Platten und Scheiben räumlich konstruieren, auch wenn der Einsatz von punktgestützten Platten nur schwer möglich ist. Vor allem die kraftschlüssige Ausbildung der Platten- oder Scheibenfugen ist anspruchsvoll und erfordert entsprechende Verbindungsmittel. Gordian Kley sieht daher eher eine prinzipielle Verwandtschaft mit dem Ziegelbau als mit dem Stahlbeton.
»Bauen mit BSP ist wie Modellbau mit Karton: Wände ausschneiden, zusammenkleben und fertig.« (Mitterberger)
Man muss sich auf die einfache Konstruktionsweise einlassen und ihre Gesetze, die immer noch Holzbauregeln sind (Kaufmann), befolgen, dann wird der Bau auch ökonomisch sinnvoll. Schwinden und Quellen sind durch die Absperrung eingeschränkt, die Platten haben aber trotzdem eine stärkere und eine schwächere Richtung, je nachdem, wie die äußersten Schichten verlaufen, was beim Konstruieren berücksichtigt sein will (Kley).
Bauen mit BSP ist dem klassischen Holzbau näher als dem monolithischen Betonbau.« (Kaufmann)
Architektonisch ist BSP durchaus attraktiv. Die einfache, großflächige Konstruktion fordert das plastische und das konzeptionelle Denken gleichermaßen heraus. Da BSP auf Sicht verwendet werden kann, besonders im Innenraum, und es glatte Flächen bietet, die den heutigen Bedürfnissen entsprechen, wirkt es großzügiger und nicht kleinteilig zusammengesetzt. Das »Gemachtsein« tritt hinter dem Raumkonzept zurück. Aufgrund der Elementbauweise ist das Erscheinungsbild »flächiger« geworden (Kaufmann). Hubert Rieß sieht einen implizit ästhetischen Aspekt für den planenden Architekten: Die Planung mit den großen Plattenelementen zwinge zur Disziplin, wobei dadurch das Interesse auch auf den Prozess – wie gebaut wird – gelenkt werde. Ein Aspekt, der heute oft gegenüber der Formfindung in den Hintergrund gerät (Rieß). Hier wird eine integrale Schönheit des Bauens angesprochen, die im aktuellen Oberflächenwahn unterzugehen droht, vom Architekten aber eine geistige Nähe zur Baustelle verlangt.
»Jeder Baustoff ist architekturfähig, aber ist es auch der Planer?« (Mitterberger)
Ohne Zweifel gibt es für das junge Konstruktionsmaterial noch einiges an Entwicklungsbedarf. Zuvorderst steht die Forderung nach einer Standardisierung der Produkte in dieselben Stärken bei allen Anbietern, z. B. in 10 mm Abstufungen, dann das Angebot von drei bis vier Qualitäten: nicht Sicht, Industrie, Sicht, Sicht+. Denn nur so sind herstellerneutrale Ausschreibungen möglich, ohne dass später womöglich umgeplant werden muss. Wenn die Elemente bereits im Werk abgebunden werden, gehen sie ohne Abladen, Abbinden in der Zimmerei und wieder Aufladen direkt auf die Baustelle, was technisch kein Problem darstellt. Kritisiert werden die langen Lieferzeiten, da nur auf Bestellung produziert wird. Auch hier brächte eine Standardisierung der Produkte gewisse Vorteile. Bemängelt wird zudem das Fehlen allgemeiner Qualitätsstandards, die manche Probleme – wie etwa ein hohes Schwindmaß einzelner Bretter – verhindern könnten.
»Eine auf Produktabmessungen abgestimmte Planung schränkt den Bieterkreis bei der Ausschreibung ein.« (Kley)
Vor allem im Bereich kraftschlüssiger Verbindungsmittel sind noch einige Entwicklungsfelder frei. Gewiss wird es aber auch von der Masse des insgesamt verbauten BSP abhängen, ob sich hier sekundäre Produktionsfelder öffnen, damit man von individuellen und damit meist teureren Detailkonstruktionen wegkommen kann.
Allgemein werden die Aussichten gut eingeschätzt, weil BSP schnell, trocken, leicht, sehr genau und schlanker als andere Konstruktionsweisen ist (Rieß). Doch geht es nun darum, das Produkt besser auf die Bedürfnisse des Marktes auszurichten. Zuvorderst sind das die Planer und die Zimmerer, denen keine unnötigen Schlaufen im Planungs- und Verarbeitungsprozess aufgeladen werden sollten, denn diese bedeuten Kosten für diese ersten Entscheidungsträger für oder gegen BSP. Die Kostenfrage für die Bauherrschaften stellt sich erst danach. Eine Standardisierung, damit produktneutral ausgeschrieben werden kann, wäre wohl ein wichtiger Schritt in diese Richtung.
Ein alter Bauernhof im Weinviertel, eine Handvoll Theater-begeisterter und jede Menge Engagement: wie sich das „Theater Westliches Weinviertel“ in Guntersdorf sein Haus erneuern ließ.
Sanft wellig dehnt sich die Landschaft des Weinviertels gegen Norden. Die landwirtschaftliche Nutzung ist weiträumig: da ein Feldrain, dort eine Hecke. Ab und an führt die Straße durch ein Dorf. Schmale Streckhofparzellen reihen sich zu beiden Seiten. Ihre Grenzen verlaufen schräg zur Straßenachse, sodass vor den Kopfbauten der niedrigen Höfe eine dreieckige Fläche bleibt. Ein kleiner Vorplatz, der heute meist asphaltiert ist. Mag sein, dass es früher einmal kleine Gärten waren.
So auch in Guntersdorf, einer Ortschaft nördlich von Hollabrunn, am Weg nach Tschechien. Doch in der regelmäßigen Struktur gleichgerichteter Streckhöfe regte es sich. Vor über zwei Jahrzehnten hatte sich eine Gruppe Menschen zusammengefunden, die Theater spielen wollten und die dies mit zunehmender Professionalisierung und großem Engagement bis heute tun. Sie nannten das Unternehmen „Theater Westliches Weinviertel“ und fanden einen alten Streckhof an der Straße, dessen 70 Meter tiefes und knapp acht Meter breites Grundstück im vorderen Teil, im ehemaligen Wohnhaus, die Garderobe, einen Proberaum und Nebenräume aufnahm, während der Theaterraum im alten Heustadel eingerichtet wurde, der zuhinterst auf dem Grundstück, direkt an der hinteren Zufahrt steht. Zwischen den beiden Teilen lag ein schmaler Hof. Die meisten Arbeiten wurden in Eigenleistung von den Theaterbegeisterten erbracht.
Der Heustadel mit dem Theater war noch einigermaßen intakt, aber die vorderen Gebäude wurden immer baufälliger und waren für den wachsenden Betrieb längst zu eng geworden. Man entschloss sich daher, einen großen Schritt zu wagen, und lud im Jahr 2005 einige Architekten zu einem Wettbewerb ein. Es siegte die Architektengruppe „t-hoch-n“, zusammen mit dem lokalen Planer Franz Fellinger junior. „t-hoch-n“, das sind Gerhard Binder, Peter Wiesinger und Andreas Pichler. Ihren Bürositz haben sie in Wien. Aber sie vermochten sich offensichtlich am besten in die Typologie des Streckhofes einzufühlen. Nach längerem Planen und der Sicherung der Finanzierung konnte im Mai 2007 mit Bauen begonnen werden. Die Projektleitung lag bei Peter Wiesinger.
Die baufälligen Gebäude im vorderen Grundstücksbereich wurden abgebrochen und durch Neubauten ersetzt, die teils eingeschoßig, im Mittelteil zweigeschoßig, der Typologie des Streckhofs folgen und so in die Dorfstruktur gut integriert sind. Als neues Element, das Vorn und Hinten verbindet, legten die Architekten ein langes, schmales Dach am Vorderhaus vorbei durch den Hof und bis vor den Theaterstadel. Die weinrot gefärbten Bretter bilden nicht nur ein Dach, sondern eher eine Art Baldachin, der mal höher, mal etwas niedriger ist, und zur Straße hin signalhaft aufgefaltet wird, damit niemand das Theaterhaus übersieht. Selbstverständlich dient das Dach auch als Witterungsschutz, doch gelang es hier mit vergleichsweise einfachsten Mitteln, eine Festlichkeit zu erzeugen, die mit der Architektur des einfachen Vorderhauses allein nicht zu schaffen gewesen wäre.
Obwohl die leichte Konstruktion in Metall und Holz nicht sehr aufwendig ist, vermag die dematerialisierende Wirkung der Farbe einen nahezu textilen Charakter zu bewirken, womit das Baldachinartige gestärkt wird, jenes provisorisch Festliche, das an Wandertheater oder Zirkus erinnert, mithin an die Ursprünge des Theaters. Das Dach ist ein wesentliches, identitätstiftendes Element, das das Theaterambiente zur Außenwirkung bringt und die Teile zusammenhält. Ein verbliebenes Satteldach von einem Nebengebäude, dessen Wände entfernt wurden, schützt nun einen offenen Foyerbereich, der vor dem Stück und in allfälligen Pausen zum Aufenthalt einlädt.
Obwohl der Theaterraum im ehemaligen Heustadel samt dessen bestehender Holzkonstruktion nur geringfügig adaptiert wurde, verdient er Beachtung, denn er ist in dem Raum, dessen Grundriss ein Rechteck im Verhältnis 2:1 aufweist, quer organisiert, was zuerst einmal überrascht. Bei näherer Analyse zeigen sich neben dem Hauptvorteil auch eine Anzahl betrieblich günstiger Aspekte. Vor allem begeistert die Querorganisation, weil sie Akteure und Publikum in eine heftige Nahebeziehung bringt, die sich sonst kaum wo findet. Die Bühne ist breit, weist zwei Seitenteile auf, ist aber natürlich nicht sehr tief. Dafür drängen sich die fünf Sitzreihen dicht davor, zusätzliche Plätze bietet eine schmale Galerie. Für Hinterbänkler bleibt da kein Raum, denn auch der hinterste Platz liegt noch im direkten Wirkungsbereich der Aufführenden. Jeder Zuschauer wird damit Teil des Geschehens. Diese besondere Konstellation, die zum einen sicher den Zwängen der vorhandenen Struktur geschuldet war, ist jedoch zugleich ein genialer Befreiungsschlag im Sinne lebendigen Theaters.
Dass Zugänge zu Nebenräumen und das Tor zum Zufahrtsweg weiter genutzt werden können, sind positive Neben- und Sicherheitsaspekte. So sind die Kernelemente der Theatergebäude – trotz ihrer Einfachheit – von außerordentlicher Qualität, was ihren Nutzen für das Schauspiel betrifft.
Die entscheidenden Verbesserungen im Neubauteil erfassten die nun getrennten Garderoben, einen Aufenthaltsbereich, Werkstätten, eine kleine Probe- und Studiobühne und einen Wohnraum für Gastdramaturgen oder -regisseure. Alles ist sehr einfach gehalten, denn Geld war gewiss nicht im Überfluss da. Aber eben, wichtig ist, was man architektonisch daraus macht.
Seit Jahrzehnten profitiert das „Theater im Stadl“ vom Engagement der Schauspielerin und Regisseurin Franziska Wohlmann. Waren es zu Beginn Laien, die sich auf die Bühne wagten, hat sich der Charakter der Gruppe verändert. Manche werden in ihrer Begeisterung Schauspielunterricht genommen haben, um sich zu qualifizieren. Dazu gestoßen sind Schauspielerinnen und Schauspieler die dies nebenberuflich ausüben, weiters junge Leute in Schauspielausbildung sowie professionelle Darsteller.
Das Programm bietet zwei bis drei Eigenproduktionen pro Jahr, zahlreiche Gastspiele aus Kleinkunst, Kabarett und Kindertheater sowie Lesungen und Musikdarbietungen. Mit der einen oder anderen Eigenproduktion konnten sogar Gastspiele in Deutschland, Belgien, Frankreich und Tschechien bestritten werden. Man kann sich nun fragen, ob derartige Kulturleistungen für ein Dorf typisch seien. Gewiss hat es mit verbesserter Mobilität, mit der Urbanisierung des ländlichen Raumes zu tun, aber ohne die Initiative Einzelner und das Mitgehen Weiterer wäre kaum etwas entstanden. Wenn sich aber einmal eine Tradition herausgebildet und festgesetzt hat, dann ist so eine Bühne Teil der Dorf- und Regionalkultur und daher typisch – für das Dorf Guntersdorf. Der große Vorteil: Theater ist analog, es ist in der Nähe, man kann mitmachen, wenn es einen packt. Da gehört Architektur einfach dazu.
Das Oberammergauer Festspielhaus hat zusätzlich ein mobiles Dach bekommen. Was so leicht und elegant aussieht, ist ein Meisterstück der Ingenierbaukunst von Karlheinz Wagner.
Zuvor noch ein Nachsatz zu meinem letzten Beitrag vom 21. Juni aus gegebenem Anlass: Derzeit schreiben und plappern alle die falsche Metapher vom „Vogelnest“ nach, wenn sie vom Olympia-Stadion in Peking berichten. Dabei erweist sich immer mehr, dass es aus der Ferne nicht wie ein bergendes Nest aussieht, sondern, wie jedes Kind bemerken würde, viel eher wie ein Käfig.
Doch wenden wir uns Naheliegenderem zu. Die Oberammergauer Passionsspiele finden seit 1634 statt, und zwar im Rhythmus von zehn Jahren. Etwa seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert steht mitten im Dorf ein 5000 Personen fassendes Festspielhaus mit Bogenträgern aus Stahlfachwerk in der Technologie damaliger Bahnhofshallen, verkleidet ursprünglich mit Holz. In jüngster Zeit erhielt das Gebäude eine äußere Schale aus Verputz, was ihm einen etwas monumentaleren Charakter verleiht.
Das Besondere an dem Haus ist, dass die Zuschauer im Trockenen sitzen, die Bühne mit Aufbauten jedoch unter freiem Himmel steht, damit der Blick aus dem Zuschauerraum einen markanten Berg erreicht, der zurSzenerie gehört. In den Jahren zwischen denPassionsspielen finden selbstverständlich ebenfalls Veranstaltungen unterschiedlichster Art statt, die jedoch weniger dem Wetterglück ausgesetzt sein sollten. Die Oberammergauer schrieben daher einen Wettbewerbunter Architekten und Bauingenieuren aus, um Entwürfe für ein mobiles Dach zu erhalten, das den Bühnenbereich über den Winterschützt, sowie gegen Regen, wenn dies bei Veranstaltungen erforderlich ist. Anlässlich der Passionsspiele jedoch muss das Dach so weit weggefahren werden können, dass es von keinem einzigen der 5000 Zuschauerplätze aus noch gesehen werden kann.
Der Wiener Bauingenieur Karlheinz Wagner, zusammen mit Architekt Christian Jabornegg von Jabornegg und Pálffy, gewann das anspruchsvolle Verfahren mit einem Dach, das entlang von zwei gekrümmten Trägern mit sich kreuzenden Erzeugenden eine hyperbolisch-paraboloide Form gewinnt. So ein Gebilde ist zwar als Idee schnell hingezeichnet, aber Konstruktion und Errichtung sind extrem anspruchsvoll. Und dann soll das Ganze noch auf sich hochkrümmenden Schienen in die eine Endposition gebracht oder wieder zurück in die hintere Endposition aus den Augen (der Zuschauer) verschwinden.
Die tragenden Schienen sind als gebogene Kastenträger ausgebildet, der Torsionssteifigkeit wegen. Das ließ sich nicht einfach so walzen, sondern musste zusammengeschweißt werden. Sie dienen als Widerlager der Dachkonstruktion, die immerhin 43 Meter Spannweite hat. In der oberen, auch für den Winter vorgesehenen Position kommen enorme Schneelasten dazu, die in speziellen Konstruktionen abgefangen werden, seitlich in den Bühnenaufbauten versteckt. Die Dachkonstruktion selbst wird in diesem Fall zusätzlich verspannt. Die Erzeugenden der Großform des Daches verlaufen als Stahlrohre kreuzweise diagonal von einem zum anderen Bogen, ein großmaschiges, gekrümmtes Netz bildend, das dem Dach seine Eleganz verleiht.
Die viereckigen Fächer zwischen den Rohren sind mit Stahlkabeln diagonal verspannt. Damit gewinnt die Konstruktion ihre Steifigkeit. Die Kräfte werden jeweils in einem komplexen Knoten konzentriert, den Karlheinz Wagner eigens entwickelt hat. Er ist so konstruiert, dass ein Knotentyp sämtliche geometrisch erforderlichen Lagen einnehmen kann und auch die Diagonalkabel entsprechend darin verankert sind und gespannt werden können. Wenn das Dach sich in der oberen Position befindet, schließt es mit einem pneumatischen Wulst dicht an das Gebäude an. Ist es in der unteren Position, bildet es ein ausladend schirmendes Vordach, das die Rückseite des Gebäudes stark aufwertet. In Oberammergau denkt man sogar daran, kleinere Veranstaltungen an der nun attraktiv gewordenen Rückseite abzuhalten.
Die Dachmembran besteht aus Bahnen eines feinen Edelstahlgewebes, die sich so weit verformen können, dass sie dem dreidimensionalen Flächenverlauf folgen können. Sie werden mit Stahlfedern in ihre Position gespannt. Im Winter müssen sie die Schneelast übernehmen können, und bei Regen dienen sie als Zerstäuber, damit die akustische Störung der Veranstaltungen minimiert wird. Das Wasser selbst wird von einer darunter gespannten Folie aufgefangen und zu den vier Fußpunkten geleitet und über Speier abgeführt.
Was auf den ersten Blick einfach aussieht, erweist sich bei näherer Betrachtung als extrem komplex und erforderte neben viel Nachdenken konkrete Versuche. Der Aufgabenbereich erfasste auch den des Maschinenbaus, nicht bloß der Tragwerksplanung und der Statik, etwas, wovon Architekten nur noch entfernt eine Ahnung haben.
Gewiss ist nicht jede Aufgabe für einen Bauingenieur derart komplex, aber dieses knapp 35 Tonnen schwere Dach gab zahlreiche Knacknüsse zu lösen, die auch einem sehr guten Bauingenieur des Nachts schlaflose Phasen bereiten können. Und am Ende schaut dann das Dach leicht und elegant aus, sodass man den geistigen Aufwand, der dahintersteckt, kaum mehr ahnt. Damit gelangen wir in den Spitzenbereich der Ingenieurbaukunst: Die Konstruktionen tragen und funktionieren mit einer Leichtigkeit, dass man die wirkenden Kräfte und schon gar die potenziell möglichen wie Wind und Schnee nicht einmal vermutet. So wird Ingenieurwerk und Ingenieurbaukunst zugleich zu Architektur. Dabei liegt die Ästhetik im Tragsystem, in den konstruktiven Details und in zahlreichen technischen Lösungen, die für das Gelingen erforderlich waren. Dank einem intensiven gestalterischen Perfektionsprozess ist aber das Bild, das sich dem Laien bietet, leicht, attraktiv und einprägsam. Gewiss ist nicht jeder Bauingenieur in diesen Dingen gleich begabt, doch der Einzelkämpfer Karlheinz Wagner offensichtlich schon.
An diesem Beispiel zeigt sich, wie spannend der Ingenieurberuf sein kann, wenn man sich die entsprechenden Herausforderungen sucht. Dass der Weg dorthin mit Mathematik dick gepflastert ist, sollte junge Menschen nicht abschrecken. Sie dient der Lösung von Problemen praktischer Natur, von denen die meisten heute nicht leiseste Ahnung mehr haben. Doch ohne die Ingenieure und ihre Leistungen wäre die Menschheit arm dran und vor allem ihre Zukunft in keinster Weise gesichert, da ein Großteil der anstehenden Probleme ohne technologische Weiterentwicklung nicht gelöst werden kann. Sparsamkeit hin oder her.
Architektur zu beschreiben setzt voraus, dass man etwas vom Gegenstand verstanden hat und den Umgang mit Sprache beherrscht. Sollte man meinen. Die meisten aber schreiben, was andere schon geschrieben haben. Oder was ihnen gerade einfällt.
Wie mag wohl ein Gebäude aussehen, das, von oben gesehen, als „futuristische Amöbe“ („Neue Zürcher Zeitung“) bezeichnet wird und im weiteren Verlauf als Wal? Sie wissen es nicht? Kein Wunder. Einen Wal kann man sich noch vorstellen, aber eine futuristische Amöbe? Aus dem Biologieunterricht vermögen wir uns zu erinnern, dass Amöben ständigen Veränderungen unterworfen sind. Wie würde sich jedoch der futuristische Wesenszug auswirken? Mehr nach den Projektionen von Futurologen oder eher nach den Erwartungen von Biologen? Wohl bestenfalls Ersteres.
Ganz fair ist mein Vorgehen zwar nicht, denn ich begann mit Sprachbildern aus einem Text, der mit einem Bild des Gebäudes versehen ist. Im Bildtext wird es als „Tornado an der Autobahn“ benannt. Klingelt es schon? Dann wird der Titel: „Gezähmter Wirbelsturm“ wohl kaum weiterhelfen. Während Tornado und Autobahn wenigstens dynamisch klingen, ist ein gezähmter Wirbelsturm eher etwas Harmloses, so wie jene Drachen in den Soft-Kinderbüchern, die unglücklicherweise nicht Feuer speien können, daher von ihren Artgenossen ausgegrenzt, von kleinen Mädchen oder Knaben getröstet und psychologisch betreut werden, damit sie wenigstens ab und an einen kleinen Funken spucken. Das leitet leider auf die falsche Spur. Dabei waren wir zwischendurch nahe dran.
Halten wir noch fest, dass in den angebotenen Metaphern mehrheitlich ein abschätziger Unterton mitschwingt, der aber nicht, oder kaum begründet wird. Also fast ein Untergriff, ist man geneigt zu sagen. Der Autor hingegen muss sich gesagt haben: „Dem – oder denen – habe ich es aber gegeben, sonst hätte er es beim Durchlesen nicht stehen lassen. Oder genügte ihm das Rechtschreibprogramm zur Kontrolle? Doch kommen wir zum Gegenstand zurück. Es wäre um Architekturkritik gegangen. Doch deren Ziel kann nicht sein, eine vermeintlich griffige Sprachfigur zu finden, die nichts erklärt. Das Gebäude scheint dem Kritiker nicht wirklich gefallen zu haben. Da und dort kommt dies im Text indirekt zum Ausdruck. Das ändert aber nichts an den schwachen Metaphern, die keine architektonische Sachverhalte vermitteln. Von wegen Tornado an der Autobahn: Es handelt sich um den Komplex der BMW-Welt in München von Coop Himmelb(l)au. Christian Kühn hat das Bauwerk – ohne schlechte Metaphern – im „Spectrum“ vom 13. Oktober 2007 eingehend besprochen.
Nun gibt es andere Bauten, deren Übernahme bekannter ist als das Bauwerk selbst. Beispielsweise die Kongresshalle von Hugh Stubbings für Berlin (1957), die der Arena in Raleigh, North Carolina (1950/53), von Nowitzki, Deitrick und Severnd nachempfunden ist. Der von den Medien immer wieder weitergetragene, dem Berliner Volksmund zugeschriebene Spottname „schwangere Auster“ bietet kaum Klärung an – oder weiß wer, wie eine schwangere Auster aussieht? Mit ihrem architektonischen Ausdruck hat dies gar nichts zu tun, dafür deutlich mehr mit unreflektiert weitergetragenen Klischees. Nachdem die Halle teilweise eingestürzt war, wurde man sich in Berlin bewusst, dass man sie eigentlich lieb gewonnen hatte, weshalb sie in gleicher Form wieder aufgebaut wurde. In der Folge legte sich das dumme und populistische Mediengeschwätz.
Ein weiteres Beispiel gefällig? Das Olympiastadion in Peking von Jacques Herzog & Pierre de Meuron und Partnern. Seit Jahren wird es medial als „Vogelnest“ verkauft. Unser bereits erwähnter Kritiker in der „Neuen Zürcher“ versteigt sich sogar dazu, die Chinesen würden dies „liebevoll“ tun. Da ist ihm wohl das Klischee der Wiener Secession dazwischen geraten, das außer den Fremdenführern niemand, und schon gar kein Wiener, und sicher nicht „liebevoll“, „Krauthappl“ nennt. Sie heißt schlicht Secession.
Aber bleiben wir beim sogenannten Vogelnest. Der Begriff entstand offensichtlich in einem frühen Projektstadium im Atelier in Basel. Das Modell im Maßstab 1:1000 oder 1:500 mochte in der Tat von oben so ausgeschaut haben, sodass sich im Büro dieser inoffizielle Projektname ergab. In einem Vortrag in Alpbach erzählte Meinhard von Gerkan (fünf Opernhäuser, vier Großbahnhöfe in China und so weiter), dass die Chinesen gern bildhafte Namen für die Bauwerke hätten und diese so viel leichter durchsetzbar seien. Wie dem auch sein mag, für das eigentliche architektonische Wesen des durchaus interessanten Stadion-Bauwerks sagt die Metapher vom Vogelnest überhaupt nichts aus. Modelle, auch Arbeitsmodelle setzen immer voraus, dass die Betrachtenden sie nicht als Objekt an sich, sondern als Hilfsmittel zur Kontrolle des Entwurfsgedankens interpretieren. Immer ist der gedankliche Schritt vom verkleinerten Maßstab zur Wirklichkeit des 1:1 zu leisten.
Den Architekten und Mitarbeitern im Atelier Herzog & de Meuron will ich nicht unterschieben, dass sie dies nicht könnten. Von allem Anfang war klar, und das lässt sich auch in ihrem parallelen Schaffen erkennen, dass sie ein Tragwerk suchten, das nicht wie ein klassisches Tragwerk hierarchisch oder anderweitig statisch funktional ausschaut, sondern bewusst astatisch wirkt und daher den Sehgewohnheiten widerspricht und aus der Distanz leicht wirkt. Das ist gewiss erstaunlich gut gelungen.
Wer sich vor ein paar Jahren die Ausstellung im Basler „Schaulager“ über die aktuellen Arbeiten des Büros angeschaut hat, erhielt dort die Hinweise, woher die Grundidee kommen könnte. Die Entwerfer befassten sich zu Beginn sehr intensiv mit der sichtbaren Kultur in China. Den Entschluss zur Teilnahme am Stadionwettbewerb fassten sie ziemlich spontan während einer Chinareise. In ihren Analysen und vor allem in ihren Projekten für China kam die Faszination für geregelt ungeregelte Muster zum Ausdruck, wie sie für Gitter, Steinteilungen und anderes Verwendung fanden und finden. Bekannt ist wahrscheinlich „cracked ice“ (gesprungenes Eis), ausgehend von dem Rissemuster, das die Eisfläche in einem Teich nach Tauwetter annimmt. Einen derartigen bildhaften Eindruck wollten die Entwerfer in ihr Bauwerk übertragen, wie sich damals in der genannten Ausstellung gut nachvollziehen ließ.
Dass aber im Inneren des Gitters aus sicher 2,5 mal 2,5 Meter messenden stählernen Kastenträgern räumlich äußerst spannende Konfigurationen des Halb-Drin, Halb-Draußen entstehen würden, ließ sich nur durch intensive Vorstellungsarbeit erahnen. Denn von außen sichtbar ist die luftige Hülle, die den eigentlichen Stadionkern großräumig umfasst. Sie verleiht dem Bauwerk jene Leichtigkeit, die zum Überleben des Vogelnest-Bildes mitgeholfen haben mag, auch wenn angesichts der realen Dimensionen im Bauwerk niemand mehr an ein Nest denken wird. Dies hindert gewisse Journalisten nicht – diesmal von „Spiegel Online“ –, deren Unkenntnis sich auch daran erweist, dass sie Rem Koolhaas als Mitarchitekten nennen, von einem Koloss zu schreiben, was nun wirklich weit daneben ist. Denn selbst wenn „Koloss“ ein klarer Begriff ist, da die architektonische Aussage falsch ist, nützt dies gar nichts.
Moderne Atmosphäre von hoher Eleganz und eine Akustik, die sich hören lassen kann: der neue Konzertsaal „Auditorium“ von Schloss Grafenegg.
Das Projekt der Dortmunder Architekten Ralf Schulte-Ladbeck und Matthias Schröder überzeugte im Architekturwettbewerb für ein neues Konzertsaal-Gebäude in Grafenegg nicht nur wegen der präzisen Positionierung, des geschickten Einbezugs der zu sanierenden Stallungen und der funktionierenden inneren Abläufe, sondern ebenso, weil das Gebäude eine klare Sichtbeziehung über den Park hinweg zur neuen Freilichtbühne und zum Schloss suchte. Obwohl das Gesamtvolumen unübersehbar bleibt, gelang es, den Eingang zwischen den beiden klassizistischen Bauwerken Reithalle und Schlosstaverne zwar nicht zu verstecken, aber solcherart zurückzunehmen, dass das Nebeneinander „ortsbaulich“ und architektonisch funktioniert. Das ansteigende Dach über dem Eingangsfoyer wird weiter hinten überragt von einer breit verglasten Loggia, von der aus der Ausblick auf den Park, den Wolkenturm und das Schloss ein durchaus herrschaftlicher ist.
Nach dem Erfolg mit dem Wolkenturm waren die Ansprüche der Bauherrschaft, der Familie Metternich-Sándor, Eigentümerin der Schlossanlage, sowie des Landes Niederösterreich, das einen nicht geringen Teil der Kosten übernahm, geweckt. Ein Bruch der Architektenpartnerschaft und wirtschaftsrechtliche Gründe zwangen jedoch die Auftraggeber bei fortgeschrittenem Rohbau, den Architekten zu wechseln. Mit Dieter Irresberger, langjähriger Partner von Wilhelm Holzbauer, fand man eine in akustisch-gestalterischen Fragen erfahrene Persönlichkeit. So ist denn das Saalinnere gestalterisch das Werk Irresbergers, akustisch das von Karlheinz Müller und seiner Firma Müller BBM, Planegg, die bereits den Wolkenturm betreute.
Der Neubau stößt in einem Winkel von zirka 20 Grad auf den Rechteckbau der Stallungen, dessen Kopf die Reithalle bildet. Der hintere Teil umfasst einen nahezu quadratischen Hof, in dem ein attraktiver Achteckbausteht. Die an die Reithalle anschließenden Prachtställe und das Oktogon wurden denkmalpflegerisch erneuert und dienen nun als respektables Pausenfoyer. In den rückwärtigen Teilen, die in ziemlich ruinösem Zustandwaren, sind nach den notwendigen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen die Vorbereitungsräume der Musiker untergebracht. Für Dirigenten und Solisten ist an der Rückseite des Saalgebäudes Raum geschaffen mit Ausblick auf die weiten Felder im Norden.
Im keilförmigen Zwischenbereich von ehemaligen Stallungen und Konzertsaal findet auch räumlich eine intensive Durchdringungstatt. Das Eingangsfoyer greift mit einem Arm in diesen Gebäudeteil hinein und führt zu den Garderoben. Die Begegnung über die Jahrhunderte auf knappem Raum ist recht gut gelungen und wird in einem kleinen, trapezförmigen Gartenhof elegant sublimiert, dessen Abschluss der zweigeschoßige, verglaste Verbindungsgang bildet, über den die Musiker zur Bühne gelangen.
Das Prunkstück ist natürlich der Saal, das eigentliche Auditorium, der als längsquadrisches Volumen in der unregelmäßig polyedrischen äußeren Hülle steckt. Die Rechteckform des Grundrisses hat sich akustisch bewährt; berühmt ist der Goldene Saal des Wiener Musikvereins.
Obwohl die Großform einem langen Quader entspricht, sind die Innenflächen nirgends parallel, damit keine störenden Flatterechos entstehen können. Den Wänden sind in einer Art positiver Kassettierung flache Volumen vorgeblendet, deren Sichtflächen geringfügig windschief ausgeführt sind. Der blassgelbliche Stucco lustro enthält einen hintergründigen Goldton, sodass der Saal einen zeitgemäßen und zugleich klassisch-edlen Charakter gewinnt. Der Farbton ist perfekt mit dem Eichenholz des Parkettbodens, der Geländerholme und weiterer Holzteile abgestimmt, deren hellste Komponente im Ton exakt getroffen wurde. Zusammen mit dem klassischen Dunkelrot der Polster und dem Aluminium der Bestuhlung ergibt sich eine moderne Atmosphäre von hoher Eleganz. Diesem – immer noch begrenzten – Aufwand zollt der bescheidenere Ausbau der Stiegen und Gänge Rechnung, der jedoch nachrüstbar geplant wurde. Auch hier befand sich Architekt Irresberger da und dort in der Rolle der 13. Fee, indem er, gestalterisch verfeinernd, Härten milderte und zugleich, Kosten sparend, eingriff. Architektonisch ist somit, trotz des notwendig gewordenen Wechsels, ein ansprechendes Bauwerk entstanden, das im Kern, dank Dieter Irresberger, den Wiener Kontext nicht zu scheuen braucht.
Die Akustik erhielt unter der in Grafenegg bereits bewährten Leitung von Karlheinz Müller ein Konzept und eine Optimierung die einiges versprechen. Da ein musikalischer Rechteckraum lang, nicht zu breit, aber hoch sein sollte, wurde der Dachraum in das raumakustisch wirksame Volumen einbezogen. Die dunkel weggeblendete Decke wurde in gerichtete und diffus reflektierende Segmente aufgeteilt. Weiters wurden alle Decken-, Wand- und freien Fußbodenflächen zur Nachhallgenerierung und Schalllenkung akustisch optimiert. So konnten die gewünschten Nachhallzeiten von 1,6 bis 2,0 Sekunden erreicht werden. Weil der Saal auch für Festveranstaltungen und selbst Kongresse genutzt werden soll, ist der Boden eben und nur im hintersten Teil gestuft ansteigend. Auch wenn manche Sichtlinien dadurch nicht ganz optimal sein mögen, ist dies akustisch unproblematisch.
Die Bestuhlung besteht konstruktiv aus Aluminiumblech, um die Brandlast gering zu halten. Bei Sitzpolstern, Rückenlehne und Armlehnen ging jedoch Bequemlichkeit vor. Eine Begrenzung der gepolsterten Flächen lässt die Sitze akustisch gleichsam neutral wirken, ob sie nun durch Zuhörende besetzt sind oder nicht. Dies gilt nicht nur bei teilweiser Besetzung, sondern vor allem für die Proben.
Über dem Podium, das sich mit mobilen Elementen je nach gewünschter Orchestertopografie verändern lässt, schweben zwei in Höhe und Neigung verstellbare, segelartig leicht wirkende Schallreflektoren. Für Kammermusik werden sie niedrig gestellt, während sie für Orchesterbesetzung höher gefahren werden. Unabdingbar sind sie allerdings für das gegenseitige Hören der Musizierenden, sodass sich das Zusammenspiel besser entwickeln und kontrollieren lässt.
Für die Verwendung des Saales für Kongresse, für die zwecks Sprachverständlichkeit eine kürzere Nachhallzeit erforderlich ist, sind hinter dem Podium und oberhalb des zweiten Seitenranges Absorberflächen vorgesehen, indem hinter Lamellenfeldern mit variablen textilen Elementen die Nachhallzeit reduziert werden kann. Selbst eine Nutzung mit elektronischer Stützung wird so möglich. Karlheinz Müller weist abschließend auf einen wesentlichen Aspekt guter Raumakustik hin: die Stille. Außengeräusche sind durch eine ausreichend dimensionierte Schalldämmung nahezu ausgeschlossen. Die Belüftung ist so angelegt, dass sie bei Konzertveranstaltungen mit Publikum nicht wahrnehmbar ist. Dass alle diese Maßnahmen nicht gratis zu haben sind, wird einleuchten. Dennoch war es von Anfang an ein Ziel der Bauherrschaft, den Kostenrahmen nicht zu sehr auszuweiten. Obwohl optisch in manchen Bereichen spartanischen Prinzipien verpflichtet, wurden an der Raumakustik keine Abstriche gemacht, wie zu hören sein wird.
Der Trend zum frei stehenden Einfamilienhaus ist unge-brochen. Dabei würde eine verdichtete Siedlung Bauland, Kosten und Energie sparen. Eine Wohnanlage in Langenlois zeigt, wie es geht.
Raumplaner und Architekten wären sich seit vielen Jahrzehnten einig: Verdichteter Flachbau spart Siedlungsinfrastruktur, Bauland, Baukosten und Heizenergie. Doch der Trend zum frei stehenden Einfamilienhaus bleibt ungebrochen, denn Einsicht in die Notwendigkeit entwickelt sich in der Regel erst unter starkem materiellem Druck. Waren es in frühen Jahrhunderten die Gefahren einer noch ungerodeten Wildnis, die ein Zusammenrücken zum Siedlungsverband in geschlossenen Dörfern ratsam erscheinen ließen, sind es heute ökologische und ökonomische Gründe, die dafür sprechen würden.
Gewiss war der habliche Einzelhof freier Bauern in ausgesuchter Lage parallel dazu eine ebenso gepflegte Form der Landnahme, die allerdings entsprechendes Vermögen sowie eine größere Anzahl Knechte und Mägde voraussetzte. Ohne Dienstpersonal und auf kleinsten Parzellen dicht an dicht errichtet, gilt das frei stehende Haus paradoxerweise noch immer als erstrebenswertes Ziel, auch wenn die offenen Restgärten im Vergleich zu den geschützten und daher angenehm privaten Gartenhöfen in einem Angerdorf eindeutig weniger attraktiv sind. Vielleicht wenn sich die Gemeinden der hohen Unterhaltskosten der Infrastruktur einmal bewusst werden, ist zu hoffen, dass eine weitere Zersiedelung gebremst wird.
Konzepte, wie Siedlungsformen in geschlossenem Verband aussehen könnten, gibt es zuhauf. Da und dort wurden sie gebaut und funktionieren, wenn der oft idealistisch vorgeplante Gemeinschaftsgeist nicht die Leistungsbereitschaft der Bewohner überfordert. Doch selbst in diesen Fällen haben sich ideologische Ansprüche verflüchtigt, und die gelebte Wirklichkeit hat sich durchgesetzt. Einer, der sich schon länger mit der Frage verdichteten Wohnens befasst, ist der Wiener Architekt Walter Stelzhammer. Für den Jahre zurückliegenden städtebaulichen Wettbewerb Süßenbrunn hatte er sich ausführlich mit der Aufgabe befasst. Das Projekt wurde beachtet, aber zu einer Realisierung kam es nicht. In besserer Erinnerung, da gebaut, ist hingegen die „Wohnarche“ in Wien-Atzgersdorf, eine kompakte Anordnung von „Reihenhäusern“ Rücken an Rücken, mit je einem integrierten kleinen Hof, dessen Glasdach geöffnet werden kann, sodass die zum Hof orientierten Räume belichtet und belüftbar sind. Großzügige individuelle Dachterrassen erhöhen den Wohnwert.
Entsprechend den gestiegenen wärmetechnischen Anforderungen und der Lage an einer ländlichen Entwicklungsachse mit großen Baukörpern von Einkaufsmärkten und dergleichen wurde das Konzept von Atzgersdorf in Langenlois neu bearbeitet und interpretiert. Zweimal sechs Einheiten stehen Rücken an Rücken und bilden eine lang gestreckte Großform, der die auskragenden Obergeschoße und die schrägen Glasdächer über den Lichthöfen ein differenziertes Erscheinungsbild verleihen. Die beiden Längsseiten blicken nach Osten und nach Westen. Am Südkopf verfügen die dortigen zwei Häuser über zusätzliche Fenster. Die Nordseite ist hingegen geschlossen und zeigt die konkrete Figur des ausladenden Querschnitts. Kleine Vorgärten ziehen sich an beiden Längsseiten vor den durch die Auskragung beschirmten Eingangsvorbereichen. Bepflanzung und Gartengerätehäuschen werden bald von der Individualität der Bewohner künden.
Heutigen Gesetzen folgend, musste die Wohnanlage Passivhausstandard aufweisen, was nur mit Wohnraumlüftung zu erreichen ist. Dies erlaubte, den Hof mit einem geschlossenen Glasdach zu versehen, sodass seine Integration ins Leben der Bewohner leichter fällt als in Atzgersdorf, wo dies von den Jahreszeiten etwas beeinträchtigt wird. Dennoch sind die Wohnräume teils mit verglasten Schiebetüren, teils mit Fenstern zum Hofraum verschließbar, da zu diesem klimatischen Pufferraum eine leichte Temperaturdifferenz besteht. Da er die Treppe enthält und als Erschließungs- und Bewegungsraum dient, stört dies kaum. Umso mehr, als ihn schon wenige Sonnenstrahlen durch das Glasdach erwärmen. Im Sommer lässt es sich beschatten.
Betreten werden die Häuser unter dem ausladenden Obergeschoß, oder einen Halbstock tiefer von der Autoeinstellhalle her. Einen halben Treppenlauf höher liegt die Hauptwohnebene mit Küche, Essplatz und Sitzgruppe sowie dem Boden des Hofraums, der als weiterer Wohnbereich, für Pflanzen, als Spielzone und anderes mehr, dienen kann. Ein tief liegendes Fenster bietet einen Blick auf den Eingangsvorbereich.
Ein halbes Geschoß höher liegen an der Vorderseite des Hauses zwei Kinderzimmer und die separate Toilette. Nach einem weiteren halben Treppenlauf gelangt man an der Innenseite zum Elternzimmer, einem Schrankraum und zum großzügigen Bad. Das Elternzimmer erhält sein Licht durch ein großes Fenster zum Hofraum, belüftet wird es durch die Wohnraumlüftung. Dieser für manche neuartige Sachverhalt erweist sich jedoch als durchaus sinnvoll, da die Raumluft auch am Morgen frisch ist.
Die hauseigene Treppe ist noch nicht zu Ende, denn über einen weiteren halben Lauf erreicht man eine kleine Arbeitsgalerie und den Ausgang auf die Dachterrasse, die sich als geschützter Außenwohnbereich anbietet. Insgesamt sind in diesen dicht aneinander gefügten Häusern die bekannten Wohnfunktionen und Zimmergrößen vorhanden. Zugleich gibt es jedoch diesen auch räumlich interessanten, glasgedeckten Hofraum, der samt Treppe ein polyvalentes Angebot darstellt, das individuell interpretiert und genutzt werden kann.
Die Eigenheit stärker zurückgezogener Räume, die von der dichten Packung der Wohneinheiten bedingt ist, wird kompensiert durch die vortemperierte Belüftung und durch das Plus des hellen Hofraumes. Was den einen als Experiment erscheinen mag, ist jedoch die Weiterentwicklung und Aktualisierung eines uralten Nutzungs- und Bautyps, den man bereits auf der Alpensüdseite kennt und der im Mittelmeerraum als introvertiertes Hofhaus beliebt und verbreitet ist. Dass er bei einer Übertragung in den Norden einer Adaptierung bedarf, ist dem Architekten selbstverständlich. Dass es sich wegen des engen Rahmens der Wohnbauförderung um ein Minimalkonzept handelt, das da und dort mit geringem Aufwand noch verbessert werden kann, was von der Planung vorbedacht wurde, soll nicht verschwiegen werden.
Dennoch hat sich die Kremser Baugenossenschaft unter ihrem Direktor Alfred Graf nach den Siedlungen in Gneixendorf, am Hundsturm und am Langenloiser Berg mit Architekt Ernst Linsberger ein weiteres Mal als innovativ erwiesen. Die Zusammenarbeit mit engagierten Architekten führt jedenfalls zu Resultaten, die sich anschauen und die das Wohnungsangebot in qualitativer Hinsicht breiter werden lassen. Denn eine größere Auswahl an Typen erlaubt individuellen Wohnwünschen die Verwirklichung, die in quasi genormten Grundrissen nach veralteten Konzepten, wie sie leider noch immer errichtet werden, nicht einmal geträumt werden können.
Vom Lichtschimmer zum Ausblick
Als der Psychiater und Anthropologe Paul Parin in einem Dogondorf im Nigerbogen einen Einwohner fragte, warum an seinem Lehmhaus keine Fenster seien, antwortete dieser: »Wozu Fenster. Wenn ich Licht brauche, gehe ich hinaus.« Nun, ganz so einfach war es auch bei diesem Lehmhaus nicht, dessen speziellen Typ Aldo van Eyck bekannt gemacht hatte, denn der runde Kopfteil der Küche braucht Licht zum Arbeiten und einen Abzug für den Rauch. Beidem dient die Tür zur Dachterrasse, die über einen Steigbaum erreicht wird. Eine Türe aber ist kein Fenster, auch wenn Jahrtausende lang das Einraumhaus mit nur einer Türe als Lichtöffnung ausgekommen sein mag.
Jedenfalls ist das Fenster entwicklungsgeschichtlich jünger als die Türe. Es wird dann erforderlich, wenn die Räume keine Außentüren mehr aufweisen und von innen über ein anderes Zimmer oder einen Gang zugänglich sind. Meist ging es darum, wenigstens einen Schimmer von Tageslicht in die umschlossene Finsternis zu holen. Dieses Problem hatten die Ureinwohner der nordamerikanischen Prärien nicht, denn die dünn geschabte Ledermembran ihrer Zelte war durchscheinend, wie der Forscher Maximilian Prinz zu Wied berichtet. Aber bei der Jurte der Kirgisen, wo die offene, zentrale Kuppel dem Rauchabzug und der Belichtung diente, ergab sich ein Problem, als mit Ofen und Rauchrohr gefeuert wurde und die Kuppel geschlossen blieb: Wo und wie macht man bei dem über Jahrhunderte perfektionierten Rundzelt aus Stecken und Filz ein Fenster?
In den Schlafkammern mancher Bauernhäuser unserer Vorfahren hatten die Blockwände in einer Stricklage eine nur 15 Zentimeter breite und hohe Lücke, damit man merkte, wann der Tag anbrach. Viele dieser Löcher wurden erst im vergangenen Jahrhundert vergrößert und mit einem verglasten Flügel versehen. Wenn es draußen kalt war, schloss eine Klappe den Luftzug aus, aber auch den letzten Lichtschimmer. Oft waren es auf Rahmen gespannte Schweinsblasen, die transluzent etwas Licht einließen, denn Glasscheiben waren kaum zu bezahlen. Wir finden sie zwar bei hochwertigen Sakralbauten der Romanik und seit der Gotik in Form farbiger Fenster als hohe Bilderwände. Normale Bürgersleute in ihren Fachwerkbauten nutzten die Möglichkeit von Fenstern aus Butzenscheiben, kleinen runden Scheibchen aus Glasschmelze, von Bleiprofilen in ein Wabenmuster gefasst, die dem Lichteinlass dienten. Um hinauszuschauen musste jedoch wegen der gestörten Optik der Flügel geöffnet werden. Größere Glasscheiben wurden in Manufakturen erzeugt, indem zylindrische Glasflaschen geblasen, Kopf- und Ansatzstück abgetrennt, der Mantel längs aufgeschnitten und flach ausgebreitet wurde. Größe und Format dieser Scheiben waren begrenzt durch die Lungenkraft der Glasbläser. Noch Joseph Paxton verwendete dieses »Modul« für das Dach des Londoner Glaspalasts.
Die teurere Variante, größere Flächen zu gießen, plan zu schleifen und zu polieren, war vor allem für Spiegel üblich oder dann und wann für exquisite Sondereffekte gut betuchter Bauherren. Die kleinen Formate bedingten Fenstersprossen aus Holz oder Metall, welche jedoch die neu gewonnene Durchsicht, die als Aussicht vermehrt eine Rolle zu spielen begann, zerteilten. Mit der Industrialisierung ersetzte zuerst Druckluft den menschlichen Glasbläser, dann kam das Floatglas auf. Die Formate wurden größer und länger. Und moderne Architekten interpretierten das Fenster neu. Es war nicht mehr wie bisher ein standardisiertes Belichtungselement im durchgegliederten historistischen Fassadenaufbau, sondern Teil der Raumwirkung sowie Regler der Beziehung von Innen und Außen. Wo in der Fassade das Fenster zu liegen kam, sollte von innen her bestimmt werden; das Fenster fasste oft einen bewusst gewählten Ausblick. Immer noch bestand es aus nur einer Scheibe, die viel transparenter war, weil nur zwei Spiegelungsebenen den Durchblick bremsten, halb so viel wie bei Isolier- oder Verbundsicherheitsglas. Dieser Effekt großer Glasscheiben in einigen Villen der 1920er Jahre lässt sich in Einzelfällen noch am Original oder an manchen Schaufensterscheiben nachvollziehen.
Mit der Auflösung der Mauer und der Einführung der Vollglasfassade seit den 1960er Jahren hat sich das Spiel von offen und geschlossen, jedenfalls für die großen Bürohäuser, verabschiedet. Wo nur noch Glaswände sind, gibt es keine Fenster mehr, denn es fehlt ihnen der architektonische Rahmen.
Das neue Life Sciences Center in Wien oder: Der Beweis, dass ein Institutsgebäude keineswegs auf architektonischen Luxus verzichten muss.
Wahrscheinlich wissen in der weiten Welt draußen mehr Leute um die im Wiener Biozentrum betriebene Spitzenforschung als in jener Stadt, in der diese Institute ihren Standort haben. Das ist zwar paradox, mag jedoch auch ein wenig an der Position im Stadtgebiet liegen. Auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs St. Marx, im Schatten der Südost-Tangente, hat sich diese Industriebrache erst in jüngster Zeit zum städtebaulichen Transformationsgebiet entwickelt, obwohl mit dem Rennweg und der Landstraßer Hauptstraße, die an verschiedenen Stellen vom Ring wegstreben, zwei starke urbane Achsen an dieser Stelle wieder zusammentreffen und mit der Querachse Schlachthausgasse einen städtebaulichen Knoten bilden. Die Zeit dieses städtebaulichen Ortes wird noch kommen, nicht zuletzt abhängig von der öffentlichen Verkehrserschließung. Und weiter nach Südosten führt die Simmeringer Hauptstraße aus der Stadt.
Mit dem Ende 2005 fertiggestellten und vorigen Dezember bis ins oberste Geschoß bezogenen Life Sciences Center der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem seit 2003 in Betrieb befindlichen „Biocenter 2“ wurde der Wiener Biozentrum-Campus entscheidend erweitert, an dessen Anfang das Institut für molekulare Pathologie und die Max F. Perutz Laboratories standen. Mit den zuletzt abgeschlossenen Planungen, die über einen Wettbewerb dem Wiener Architekten Boris Podrecca übertragen wurden, setzte auch an diesem Ort städtebauliches Denken ein. Das „Biocenter 3“ ist im Bau, und in der weiteren Entwicklung ist im Binnenbereich des Campus ein begrünter Hof vorgesehen.
Doch vorerst muss man sich mit den beiden Neubauten begnügen, deren Fassaden wenig vom Innenleben preisgeben, auch wenn sie im einen Fall in Stein mit unterschiedlich bearbeiteten Oberflächen, im anderen Fall aus plissiertem und eloxiertem Aluminium bestehen. Diese Oberflächen wirken belebend auf die langen Fassaden, hinter denen sich Büros und vor allem Labors befinden. Räumlich interessant wird es allerdings überraschenderweise im Inneren der Gebäude. Das „Biocenter 2“ weist einen hohen Lichthof auf, in den erkerartig verglaste Aufenthaltsbereiche vorstoßen und den Raum plastisch aktivieren. Eine expressive Farbigkeit unterstützt die Raumwirkung. Junge Firmen der Biotechnologie machen hier ihre ersten selbstständigen Schritte.
Das Life Sciences Center enthält auf drei unterirdischen und sechs oberirdischen Geschoßen das Institut für Molekulare Biotechnologie sowie zuoberst das Gregor-Mendel-Institut für molekulare Pflanzenbiologie. Beide benötigen vor allem Laborflächen und Büros. Podrecca strukturierte das Bauvolumen in vertikalen Schichten, die parallel zur Dr.-Bohr-Gasse verlaufen. Direkt an der Fassade liegen die Büros, dahinter verläuft ein Gang. Dann kommt ein Streifen, in dem die vertikalen Erschließungen, Aufzüge und Fluchttreppen, liegen, aber ebenso schluchtartige Vertikalräume, die als Lichthöfe mit ihrer plastischen Durchformung und Einblicken von den Gängen her dem Haus einen starken architektonischen Kern verleihen, der identitätsbildend wirkt. In einer weiteren Schicht liegen die Dunkelräume, wo die Arbeit kein Tageslicht verträgt, dann folgen wieder ein Gang und endlich die Labors, vor denen sich über die gesamte Länge ein riesiger Wintergarten hinzieht, den nach Südosten eine Glaswand abschließt.
Quer zu dieser Ordnung durchstoßen auf jedem Geschoß drei Gänge das Gebäude und münden in Balkonen, die in den Wintergarten hineinragen, von wo der Blick auf einen alten, zur Absiedelung vorgesehenen Industriebetrieb fällt, wo sich in Zukunft der Gartenhof des Campus befinden wird. Diese Quergänge unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie zu den Vertikalräumen in Beziehung stehen, und stützen mit ihrer Transparenz die Orientierung im Gebäude. Das rationale System weist eine Struktur ähnlich jener einer römischen Gründungsstadt auf, mit Cardo und Decumanus, welche die Insulae der Labors gliedern, das Ganze gestapelt auf mehreren Ebenen. So viele, dass man die Übersicht verlieren würde, sind es nicht, und ein paar wesentliche, architektonisch aufgeladene Elemente unterstützen die Ortung.
Im Vordergrund steht da die Haupttreppe, die offen in der Erschließungsschlucht verläuft. Ihre Besonderheit ist ein heute unüblich gemächliches Stufenverhältnis von 10,5 Zentimeter Steigung und 43 Zentimeter Auftritt. Dieses Stufenverhältnis verleiht dem Treppensteigen, ob aufwärts oder abwärts, einen besonderen, verlangsamenden Reiz. Man findet solche Treppen sonst nur noch in Bauwerken des 19. Jahrhunderts, etwa in der ehemaligen Tierärztlichen Hochschule von Johann Aman, heute Hochschule für Musik und darstellende Kunst; im Palais des Erzherzog Ludwig Viktor von Heinrich Fers- tel, heute Burgtheater-Kasino; in Gottfried Sempers und Carl Hasenauers neuer Hofburg und im Burgtheater sowie natürlich in Otto Wagners Wohnhäusern. Der Funktionalismus des 20. Jahrhunderts eliminierte diese kultivierten Inszenierungen des Treppensteigens, und das Aufkommen der Aufzüge schien sie ganz überflüssig zu machen. An den Architekturschulen waren großzügige Treppen kein Thema mehr. Und ein weiteres Mal hatte sich eine Hauptkrankheit der Moderne, die Manie, das Kind mit dem Bad auszuschütten, durchgesetzt.
Umso mehr überrascht nun Boris Podrecca mit seinen angenehm zu beschreitenden flachen Stufen, die den Wechsel vom einen zum anderen Geschoß zum raumzeitlichen Erlebnis werden lassen, deren ausladende Absätze bei der Wende auf halber Höhe zum kurzen Verweilen einladen und den Blick in den von oben belichteten Vertikalraum, in die „Schlucht“ mit den offenen Gangfenstern, akzentuieren. Diesen architektonischenLuxus hätte man in einem naturwissenschaftlichen Institut nicht unbedingt erwartet. Für eine Institution wie die Österreichische Akademie der Wissenschaften mit ihrer historischen Tiefe und kulturellen Breite ist er allerdings absolut angemessen.
Im Übrigen wurde durchaus gespart. Der rohe Sichtbeton wird mit scharfen Kanten nobilitiert. Farbige Bodenbeläge in den Gängen erzeugen eine heitere Stimmung, und die Ausblicke zum Licht sowie die Aufenthaltsbereiche im Wintergarten bieten den imHaus Arbeitenden jene wichtigen Freiräume, die der Kurzerholung und dem spontanen wissenschaftlichen Diskurs dienen, dessen Bedeutung in Fachkreisen längst anerkannt ist. Und natürlich wird dort auch geraucht.
Das Erdgeschoß weist als Besonderheit einelliptisches Auditorium mit knapp 130 Plätzen auf, dessen ausgezeichnete Akustik auf elektronische Verstärkung locker verzichten kann. Die innen und außen geschuppt angebrachten Tafeln sind mit Eschenholzfurnier versehen und machen den Großraum als eingefügten Leichtbau erkennbar, seine starke Form wird von den Stülpungen relativiert. Rationalität und feines Gefühl sind an diesem Bauwerk gut ausbalanciert, obwohl die Anmutung der Labors und jene der allgemeinen Räume weit auseinanderliegen. Doch gerade aus dieser Spannung gewinnt das Bauwerk seine die nackte Funktionalität übersteigende architektonische Qualität.
Ein rares, schutzwürdiges Dokument der österreichi-schen Moderne: der Piaristensteg in Horn. Die geplante Sanierung bedroht nun seine außerordentliche Eleganz.
Vom dreieckförmigen Hauptplatz in Horn führt ein unscheinbarer Durchgang durch die äußere Häuserzeile zu einem Steg, der in zwei eleganten Bogen zehn Meter hoch über die Taffa führt, das Flüsschen, das an dieser Längsseite die alte Stadt bespült. Die wichtige Fuß- und Radwegverbindung dürfte recht alt sein, auch wenn die derzeitige Brücke, von der man einen prächtigen Panoramablick auf die Stadt und das ehemalige Piaristenkloster genießt, auf 1937 datiert. In Eisenbeton errichtet, zeugt sie vom Credo ambitionierter Bauingenieure, mit einem Minimum an Material ein Maximum an Leistung zu erzielen.
Die statisch als Dreigelenksbogen wirkenden zwei Haupttragwerke mit rund 30 Metern Spannweite sind an den Auflagern kräftiger und nehmen zur Mitte hin in ihrer Stärke ab. Auf den Bogen sind quer stehende Scheiben aufgeständert, welche die dünne Fahrbahnplatte tragen. Die Stärke dieser Scheiben nimmt zur Mitte hin ebenfalls ab, sodass sie trotz geringerer Höhe jeweils schlanke Proportionen aufweisen. Die Fahrbahnplatte selbst wirkt mit ihrer geringen Stärke wie ein über die aufgeständerten Scheiben gespanntes Band. Ein luftiges Geländer aus vier parallelen Eisenrohren beeinträchtigt das klare Erscheinungsbild in keiner Weise. Jeder Teil dient dem Gesamtkonzept von außerordentlicher Eleganz und Konsequenz, das als modernes und zugleich klassisches Brückenbauwerk unsere Wertschätzung verdient.
Der Entwerfer dieser Fußgängerbrücke, der Bauingenieur Friedrich Ignaz Edler von Emperger (zusammen mit dem Ingenieur Karl Kugi), ist nicht irgend ein Bauingenieur, sondern war ein wichtiger österreichischer Eisenbetonpionier der ersten Stunde. 1862 im böhmischen Beraun, tschechisch Beroun, geboren, studierte er an den Technischen Hochschulen von Prag und Wien. Er war Schüler des wichtigen österreichischen Bauingenieurs Joseph Melan (1853 bis 1941) und arbeitete ab 1890 als Ingenieur in New York, eine Erfahrung, die ihm ein, zwei Jahrzehnte Vorsprung in der Erkenntnis kommender Entwicklungen ermöglichte. 1893/94plante und errichtete er nach dem System Melan, das er in den USA vertrat, die Edenparkbrücke in Cincinnati und machte damit in den Staaten die Bauweise in Eisenbeton populär. 1897 kehrte er nach Wien zurück, war Privatdozent an der Technischen Hochschule, gründete 1901 eine Zeitschrift die lange unter dem Titel „Beton und Eisen“ erschien. 1903 war er unter den ersten Ingenieuren, die das neu erworbene Promotionsrecht der Technischen Hochschule Wien wahrnahmen. Mit dem ab 1905 herausgegebenen „Betonkalender“ schuf er ein Handbuch für Fachleute, das bis heute, immer aufs Neue überarbeitet, erscheint. Emperger verstarb im Februar 1942 in Wien.
Nach der von ihm vertretenen „Methode Emperger“, bei der mit Armierung umschnürte und von Beton ummantelte gusseiserne Druckglieder zum Einsatz kamen, sodass die Sprödigkeit des Gusseisens durch diese Kombination relativiert wurde, errichtete er an der Internationalen Bauausstellung in Leipzig, 1913, die Schwarzenbergbrücke, einen Fußgängersteg mit 42 Meter Spannweite. In Unterleitenbach in Franken wurde 1913/14 eine weitere Brücke dieses Systems mit 52 Meter Weite über den Main gebaut. Die letzte Brücke dieser Art entstand 1925 bei Gmunden, die Traunfallbrücke, die 71 Meter überspannte. Keine dieser Brücken steht heute noch, weil seither die Verkehrslasten stark zunahmen, aber allen gemeinsam war eine spezifische Eleganz, die einerseits Empergers System der schlanken Tragglieder, andererseits aber ebenso seinem offensichtlichen Formgefühl und seiner ästhetischen Kompetenz zu verdanken waren. Das System umschnürter Stützen, das eine bessere Ausnützung der Betontragfähigkeit und schlankere Proportionen erlaubt, zu dem Emperger theoretische Grundlagen lieferte, ist heute allgemein verbreitet.
Der Piaristensteg in Horn, den Friedrich Emperger mit bereits 75 Jahren entwarf und der die große Erfahrung des Neuerungen stets aufgeschlossenen Geistes belegt, ist offensichtlich eines der letzten Bauwerke aus seiner Hand, die noch existieren. Es ist daher ein wichtiges ingenieurbaugeschichtliches Denkmal, in seiner außerordentlichen Eleganz zugleich ein rares Dokument der österreichischen Moderne vor dem Zweiten Weltkrieg und nicht weniger schutzwürdig als etwa ein Bauwerk von Adolf Loos. Im Wissen um den kultur- und technikgeschichtlichen Hintergrund ist die Forderung nach integralem Schutz und sorgfältigster Sanierung unter exakter Wahrung der ästhetischen Erscheinung, wie sie der Bauingenieur Karlheinz Wagner erhebt, mehr als berechtigt. Ein aktuelles Sanierungskonzept sieht jedoch eine extreme Verdickung der zu erneuernden Fahrbahnplatte und historisierende Geländer vor, was den zutiefst modernen Formen dieser Brücke brutal widerspricht.
Keine Frage, dass Abplatzungen an Kanten und die Korrosion von Armierungseisen saniert werden müssen. Die Technologie dafür ist heute Standard. Dass auch einzelne Teile, wie die Fahrbahnplatte, deren Tragfähigkeit nicht mehr den Sicherheitsanforderungen genügt, zu erneuern sind, ist verständlich. Bei allen diesen Arbeiten ist jedoch zu bedenken, dass man ein einmaliges Bauwerk vor sich hat. Das mag den Bürgern von Horn, die den Anblick gewohnt sind, seine Erscheinung mittlerweile etwas schäbig finden könnten und die sich funktionale und technische Verbesserungen wünschen, nicht selbstverständlich sein. Aber woher sollen sie dies wissen, wenn es ihnen niemand sagt. Das Wissen um die Geschichte der Ingenieurbaukunst ist das Privatvergnügen einiger weniger Fachleute. Es gehört nicht zum Ausbildungsstoff von Bauingenieuren, was diesen verunmöglicht, ein verbessertes Verständnis ihrer ureigensten Disziplin zu erlangen. Ganz zu schweigen davon, dass auch gestalterisch-ästhetische Kompetenz bei Ingenieuren dem Zufall überlassen bleibt.
Umgekehrt wurden die ingenieurwissenschaftlichen Fächer in der Architektenausbildung unnötigerweise zurückgedrängt, sodass den meisten Architekten, wenn sie für die Gestaltung von Ingenieurbauwerken beigezogen werden, die Kompetenz für das Verständnis von Tragsystemen sowie statischer und materialtechnologischer Aspekte abgeht. Und Kenntnisse zur Geschichte der Ingenieurbaukunst, die ihnen Hintergrundwissen bieten könnten, sind erst recht nicht vorhanden, wo schon die Architekturgeschichte zum Orchideenfach reduziert wird. Aufgesetzte Behübschungen sind die Folge.
Aber ein Fußgängersteg eignet sich recht gut für eine das Denkmal schützende Pflege, weil der finanzielle Aufwand und die zu berücksichtigenden Lasten sich in einem überschaubaren Rahmen bewegen. Es käme daher einem Schildbürgerstreich nahe, wenn die grundlegende Qualität des Piaristenstegs, die bloß aus ihrem Dornröschenschlaf ins kulturelle Bewusstsein geholt werden müsste, aus fehlendem Wissen und mangelnder Sensibilität zerstört würde. Die übliche Ausrede, man habe das alles nicht wissen können und leider sei es jetzt dafür zu spät, darf nicht gelten, denn die Fakten liegen dank Bibliotheken und Internet auf dem Tisch.
Einmal Bregenz, einmal Wien: Zwei große Ausstellungen widmen sich den Werken von Peter Zumthor und Coop Himmelb(l)au. Mit unter-schiedlichen Konzepten – und in beiden Fällen nicht frei von Aura und Pathos.
Obwohl beide gern Zigarren rauchen, könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Wolf D. Prix, Frontmann von Coop Himmelb(l)au, und Peter Zumthor, Haldenstein. In Form groß angelegter Ausstellungen blicken beide auf ihr Werk zurück. Zumthor in dem von ihm entworfenen Kunsthaus in Bregenz, Prix im von Peter Noever geleiteten Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien. Beide genießen in gewisser Weise Heimvorteil, doch die Grenzen des Mediums „Architekturausstellung“ sind für jeden Anlass genug, deren Eigengesetzlichkeiten auch als spezielles Projekt zu verstehen. Ausstellen heißt herzeigen. Je nach Temperament ist daher die Inszenierung heftiger oder unterkühlter.
In Bregenz füllt Peter Zumthor das ganze Haus, das wie nebenbei, als originales Werk aus seiner Hand die Ausstellung umfängt. Im Erdgeschoß sind es große Modelle, etwa jenes zum Kunstmuseum Kolumba in Köln, in das man den Kopf hineinstecken kann, um sich einen Eindruck des dortigen Raumes zu erarbeiten. Ja, erarbeiten, denn das Modell hat einen kleineren Maßstab als das Original, und diese Distanz gilt es mit der eigenen Vorstellungskraft zu überbrücken. Natürlich hat so ein Modell auch als Objekt an sich eine nicht unwesentliche Ausstrahlung, aber das kann vom architektonischen Sachverhalt, für das es als Arbeitsinstrument diente, auch ablenken.
Die nächsten beiden Geschoße gehören den Filminstallationen von Nicole Six und Paul Petrisch. Die beiden Künstler haben zwölf Bauwerke Zumthors aus den vergangenen 20 Jahren filmisch aufgenommen. Das konsequent durchgehaltene Konzept sah jeweils sechs feste Kamerastandpunkte vor, von denen gleichzeitig gefilmt wurde. In den Ausstellungsräumen werden die laufenden Bilder in derselben Konstellation auf große, den Raum gliedernde Leinwände projiziert. Von allein wird man diese Zusammenhänge kaum merken, umso mehr, als die Bilder auch auf den Rückseiten – spiegelverkehrt – zu sehen sind. Aber das tut nichts zur Sache, denn ausstellungsdidaktisch handelt es sich um eine hochinteressante Innovation. Die Bilder scheinen vielleicht anfangs festgefroren, als wären sie Fotografien. Doch Blätter und Zweige bewegen sich im Wind und Menschen gehen durch die Räume, einmal schleicht auch eine Katze vorüber. Sonst passiert eher wenig. Aber die Filmbilder werden von der originalen Tonspur begleitet. Dies liefert ein unschätzbares Indiz des Dreidimensionalen, das den Betrachter von den analog zur Aufnahmesituation aufgestellten Projektionsflächen nicht mit der gleichen Direktheit erreicht. Das Ohr verhält sich eben anders als das Auge. Als Normalbesucher wird man es allerdings kaum schaffen, alle zwölf, 40 Minuten lang laufenden filmischen Sequenzen anzuschauen, man wird sich ein- und wieder ausklinken und erhält gleichzeitig den Eindruck des Beiläufigen (die Sicht) wie den des Monumentalen (das Konzept).
Im obersten Geschoß werden Arbeitsmodelle, Skizzen und Pläne auf hohen, einfachen Tischen und Podesten präsentiert. Sie geben Einblick in die synthetisierende Arbeitsweise des Architekten und dokumentieren nebenher den Abschied von Reißschiene und Dreieck aus den Ateliers. Bei einigen der perfekt gezeichneten Pläne kommtschlicht Wehmut auf.
Im Wiener MAK gelangt man von der Weiskirchnerstraße in den zentralen Raum für Wechselausstellungen. Eine eigens errichtete Tribüne erlaubt den Blick auf eine große, von einer schräg laufenden Gasse geteilte, transluzente Plattform, auf der über 300 Modelle unterschiedlichen Maßstabs und Arbeitsfortschritts zum Schaubild einer Stadt arrangiert sind. Entlang den Rändern und an der Diagonale lassen sich die auf Augenhöhe befindlichen Modelle studieren. Für wissbegierige Besucher sind sie auch minimal beschriftet.
Bald einmal wird es jedoch finster, und es setzt eine Video- und Lichtschau ein. Die Plattform beginnt blau zu leuchten, Blitze zucken, und an der Wand gegenüber der Tribüne setzt eine Videoprojektion ein. Alles geht sehr schnell, kaum angetippt, haben die Aspekte auch wieder gewechselt. Dazwischen gibt ein jovialer Wolf D. Prix Kleinodien der Erkenntnis aus seinen 40 Jahren Praxis preis. Man erfährt etwa, dass die wesentlichen architektonischen Entscheide beim Entwurf gefällt werden. Das wird man sich merken müssen.
In autonom bestimmter Wahrnehmungsgeschwindigkeit kann man im dreiseitig anschließenden Galerieraum die drei wichtigsten Werke von Coop Himmelb(l)au der jüngsten Zeit betrachten: BMW-Welt, München; Musée des Confluances, Lyon; Europäische Zentralbank, Frankfurt am Main. Hier lässt sich der Werdegang und die weitere Entwicklung der Projekte studieren. Und es zeigt sich, wie aufwendig es bei diesen Größenordnungen ist, die Konstruktion architektonisch nicht in gewohnten Bahnen verlaufen zu lassen und Sehgewohnheiten auszutricksen. Etwas enttäuscht nimmt man zur Kenntnis, dass das Bild der luftigen Wolke, das man von den Renderings des Musée des Confluances in Erinnerung hat, sich in der weiteren Bearbeitung verändert hat: Schwer ist sie geworden und zu Boden gegangen. Aber Modelle sind ja nicht das Bauwerk.
Im Vergleich verzichten beide Ausstellungen nicht auf Aura und Pathos. Bei Zumthor sind es das bedächtige Wesen des Baumeisterarchitekten, des unbeirrbaren Arbeitens an der Idee, am Material, an beider Wirkung und dann an der Herstellung, bis das Bauwerk lapidar und selbstverständlich dasteht und für zeitgenössische Architektur erstaunlich breiten Anklang findet. In Summe, als Projekte nebeneinander gestellt und versuchsweise im Kopf zu ihrer architektonischen Größe zur Vorstellung gebracht, kann das mitunter anstrengen, fast zu viel werden. Aber Zumthor, in seiner großväterlichen Geduld, lässt dem Besucher die Zeit.
Für Wolf D. Prix scheint sich in seinem Avantgardeverständnis wenig verändert zu haben. Mit „Architektur muss brennen“ meint er weniger den platten Vergleich als den Widerspruch, der ausgelöst werden soll. Er pflegt das Image des Rebellischen, und wie die älter gewordenen Rockstars ihre Songs, mischt er mit der gleichen Selbstverständlichkeit ältere und neuere Werke, bringt sie parallel und synchron an die Rampe, um die Zugehörigkeit zur immerwährenden Avantgarde zu beteuern. Er lässt mit seiner Inszenierung dem Betrachter jedoch kaum Zeit um wahrzunehmen. Er vermittelt eine Stimmung, doch Architektur bleibt etwas anderes. Man muss sie weiterhin an Ort und Stelle besichtigen.
Im Urner Reusstal und in der Leventina haben Bahn- und Strassenbau die Topografie und die Kultur neu modelliert. Doch woraus besteht die Verkehrskulturlandschaft, und was haben die Einzelteile miteinander zu tun? Viele Teile sind unsichtbar geworden, überwachsen, vergessen oder selbstverständlich. Sie müssen entdeckt und in Sprache gefasst werden, damit sie wieder sichtbar werden. Der Autor dieses Artikels wurde von den SBB mit dieser Aufgabe betraut. Er sucht nach Methoden und Worten.
Die hochgradig technisch geprägte Kulturlandschaft im Urner Reusstal und, in etwas geringerem Mass, in der Leventina ist Zeugnis einer schrittweisen und in vielem pragmatischen Entwicklung – pragmatisch im durchaus positiven Sinn des in der jeweiligen Epoche sowohl technisch als auch ökonomisch gerade noch Machbaren. Nicht einzelne Sensationen, sondern die Gesamtleistung von Generationen bildet daher mehr und mehr den Anlass für die Faszination, die in den vergangenen Jahren mit der zunehmenden zeitlichen Distanz breitere Kreise erfasst hat.
Seitens der SBB ist man sich dieses Phänomens schon seit einiger Zeit bewusst. Dies führte zur Erarbeitung eines Inventars der Hochbauten an der Bergstrecke zwischen Erstfeld und Biasca, das mit wissenschaftlicher Detailschärfe den über die Jahre angewachsenen, veränderten und oft erneuerten Bestand auflistet und eingehend beschreibt. Doch in den beiden Bergtälern verläuft nicht nur eine doppelspurige Eisenbahnlinie der Nord–süd-Transversale, sondern es liegen darin auch die parallelen und teilweise überlagerten Systeme des Individualverkehrs: Saumpfad, Fahrstrasse, Autobahn, weiter die Anlagen für Produktion und Transport von Strom sowie mannigfaltige Schutzmassnahmen gegen Wildbäche, Lawinen, Steinschlag und Murabgänge (Rüfen), dazu militärische Anlagen zur Kontrolle des von der Bahn geschaffenen Korridors durch die Alpen. Sie alle sind eingebettet in eine von Fluss und Gletscher geformte alpine Topografie, die eine Folge von Landschaftsräumen unterschiedlichen Charakters aufweist.
In der Summe ist das sehr viel, und doch wird eine Fahrt über die Gotthard-Bergstrecke als ein grosses, nichtsdestotrotz stark komprimiertes Gesamtereignis wahrgenommen. Es war daher die Absicht der Verantwortlichen des Inventars, Toni Häfliger und Karl Holenstein, eine Zusammenschau anzustreben, die Bahnstrecke als Teil dieser technischen Landschaft zu betrachten und die Interdependenzen mit den anderen Systemen der technischen Infrastruktur als zusätzliche Faktoren der Sinnstiftung mit einzubeziehen.
Dem mit dieser Aufgabe betrauten Schreibenden stellte sich bald die Frage, ob die Wahrnehmung aus dem bewegten Eisenbahnzug dafür überhaupt geeignet ist. Der schräg nach vorn oder nach hinten zielende Blick aus dem Wagenfenster vermag näher Liegendes kaum zu erfassen, und schon ist es wieder verschwunden. Nur was etwas weiter entfernt ist, kann länger fixiert und somit «erkannt» werden. Eine Führerstandsfahrt bietet den von der Autofahrt bekannten frontalen Ausblick, der wesentlich ruhiger ist, weil man weiter vorausschauen und weniger auffällige Elemente der Bahninfrastruktur in Geleisenähe besser erkennen kann. Längeres Betrachten geht jedoch nicht, da sind selbst die 70 km/h, mit denen eine Güterzuglokomotive die Steigung bewältigt, viel zu schnell. Dazu kommt, dass ein nicht geringer Teil der Fahrt in kürzeren und längeren Tunneln verläuft, sodass dem Kontinuum der Bewegung ein stark fragmentierter Eindruck entgegensteht. Obwohl die Sicht aus dem fahrenden Zug hinaus ein wesentlicher Aspekt der «Erfahrung» und daher unabdingbar bleibt, kann sie keinesfalls genügen. Es ist daher zwingend, sich eine Aussensicht zu erarbeiten, die eine Gesamtvorstellung der durchfahrenen Landschaftsräume anstrebt. Dieser Versuch wird vom Überblick zum Einzelobjekt führen, doch er wird manche Lücken bewusst stehen lassen müssen, denn bis in alle Details vordringen zu wollen wäre vermessen. Dennoch ist der grosse Rahmen für das Gesamt- wie das Teilverständnis wesentlich.
Das ideale Vorgehen ist daher die immer wiederkehrende Annäherung an die Bahnlinie zu Fuss, unterstützt durch ein Fahrzeug. Damit wird die Kantonsstrasse zur Basislinie der Landschaftswahrnehmung, von der aus in intensiven Begehungen immer wieder die Nähe zur Bahntrasse gesucht wird, um die einzelnen Elemente in der Vorstellung zu einem Gesamteindruck zu verdichten. Selbstverständlich sind dabei Strässchen und Wege eine willkommene Hilfe, denn Wege entlang der Bahnlinie finden sich nur auf kurzen Teilstrecken. So präzisiert sich die etappenweise gewonnene Vorstellung mehr und mehr, und Zusammenhänge werden ersichtlich, die sich einem aus dem fahrenden Zug heraus nie erschlossen hätten. Eine unschätzbare Hilfe bildet zudem das in der Schweiz vorhandene ausgezeichnete Kartenwerk im Massstab 1 : 25000.
Die Dichte der technischen Infrastruktur im Tal bringt es mit sich, dass plötzlich gar vieles interessant wird. Vor allem wenn es zu Annäherungen, Kreuzungen, Überlagerungen und Engstellen der Systeme kommt, wenn sich die Bauwerke von nahe besehen und sogar anfassen lassen, wenn eine Brücke, über die sonst nur die Züge fahren dürfen, dem Fussgänger ebenfalls die Überwindung des topografischen Hindernisses zugesteht. Diese Begegnung zweier Massstäbe im doppelten Sinn – mächtiges Bauwerk–Mensch und Schritttempo–Eisenbahntempo – birgt einen hohen Erlebniswert, der nicht unterschätzt werden soll. Sigfried Giedion weist in «Bauen in Frankreich» (1928) auf dieses besondere, gleichsam überwältigende Gefühl hin: «In den luftumspülten Stiegen des Eiffelturms, besser noch in den Stahlschenkeln eines Pont Transbordeur, stösst man auf das ästhetische Grunderlebnis des heutigen Bauens.» Auf dem Fussweg zwischen den Stahlkastenträgern der Reussbrücke bei Intschi, wo als Lichtquelle und Gehfläche nur die Gitterroste unter den Füssen dienen, packt einen hoch über den Strudeln der Reuss dieses Gefühl ebenso heftig. Und wenn dann noch ein Zug über die Brücke rollt und die Topflager ächzen, kann es Manchen sogar zu viel werden. Eine Achterbahn ist da weniger elementar. Es sind diese Nebenerträge der Primärleistung von Kunstbauten, die den neuartigen Erlebniswert für Wandernde enorm steigern. Nach einer solchen Begehung mit Direktkontakt befährt man die Strecke mit ganz anderen Augen.
Eine derartige Annäherung wird erst möglich, wenn die Hemmschwellen, die infolge einer massiven Veränderung des gewohnten Landschaftsbildes in den Köpfen entstanden sind, durch Gewöhnung abgebaut oder niedriger werden, wenn – oft nach Jahrzehnten – die Historisierung eintritt und die Werke der Ingenieure gleichsam zu Topografie geworden sind, einer von Menschen gemachten Topografie notabene, in der wir desto mehr zu sehen und zu erkennen vermögen, je mehr wir technik-, kultur- und sozialgeschichtlich darüber wissen. Das heisst nun nicht, dass die Strecke mit erläuternden Tafeln gespickt sein muss. Denn zuvorderst steht das spontane Schauen, das niemandem genommen werden soll. Daraus ergeben sich Fragen. Ein handlicher Führer oder gar nur ein Faltblatt dürfte genügen, denn individuelle Entdeckerfreude und Erkenntnisvermehrung sollen nicht durch pädagogistische Erläuterungen geschmälert werden; man kann eine Sache auch zu Tode vermitteln. Am stärksten sind diese Werke, wenn Stein, Stahl und Beton sowie Dimensionen und Leistung unmittelbar wirken.
Das heisst dennoch nicht, dass die neu gewonnene Sicht auf die technische Kulturlandschaft nicht in ein anderes Medium, sei dies Fotografie oder wie bei der vorliegenden Aufgabe Sprache, gefasst werden darf. Abschliessend und vollumfänglich wird dies sowieso nicht gelingen, aber die beschreibende, interpretierende Annäherung ist jedenfalls erlaubt. Daraus ergeben sich – in anderen Medien – eigenständige Werke, die mit dem Objekt der Betrachtung in mehrfacher Beziehung stehen.
Für eine textliche Annäherung werden die Strukturierung in Systeme und Elemente, eine Gliederung in Abschnitte und Einzelobjekte sowie Überlagerungen und Details nützlich sein, um der Fülle an Material und Eindrücken ordnend beizukommen. Dabei wird unschwer feststellbar, dass hinter jeder Massnahme mehrheitlich rationale, ihrer Zeit entsprechende Überlegungen stehen und auch das Gesamtsystem klare Gesetzmässigkeiten aufweist. Das Verhältnis zur alpinen Landschaft war jedoch eher nüchtern, gleichsam absichtslos. Diese spezifische Absichtslosigkeit, wie sie zur Bauzeit der Gotthardbahn und dann auch wieder von 1950 bis 1980 vorherrschte, bringt nicht selten Neues hervor, das sich erst im Nachhinein als solches erkennen lässt. Sie lässt sich nicht willentlich und künstlich herbeiführen. Wenn wir aber heute diese Infrastrukturbauten analysieren, entfernen wir den Schleier gleicher Gültigkeit und holen die Dinge ins Bewusstsein. Damit eignen wir sie uns neuerlich an und machen sie zu etwas Besonderem, zu Geschichte. Als Fachleute wie als Entscheidungsträger, die darüber Bescheid wissen, sind wir in der Folge für die Integration kommender Veränderungen verantwortlich.
[ Walter Zschokke, Architekt ETH und Autor ]
Ein Pensionistenheim, das nicht wie ein Krankenhaus aussieht? Durchaus möglich. Gerhard Lindner hat es bewiesen – in Waidhofen an der Thaya.
Waidhofen an der Thaya liegthoch oben im nördlichen Waldviertel und wurde bisher von aktuellen Entwicklungen hin zu engagierter zeitgenössischer Architektur kaum gestreift. Außerhalb des historischen Zentrums findet sich eine wilde Mischung beziehungslos hingewürfelter Bauten, deren erborgte Formen entfernt an schwache Derivate der Postmoderne erinnern. Robust, wie sie sind, werden sie kaum einstürzen, von einem architektonischen Bewusstsein oder Gespür ihrer Erbauer kann jedoch keine Rede sein.
Doch auch hier werden neuerdings Zeichen gesetzt. Das kürzlich in Betrieb genommene, von Architekt Gerhard Lindner entworfene Landespensionistenheim sticht aus dem belanglosen Umfeld heraus, nicht etwa der sensationellen Formen wegen, auch wenn seine Erscheinung durchaus zeitgenössisch ist, sondern weil die städtebauliche Gliederung in mehrere Trakte den Umraum aktiviert. Das Bauwerk steht nicht nur simpel irgendwie auf dem Grundstück; vielmehr ist das umfangreiche Volumen in drei Pflegetrakte aufgeteilt, die nach drei Seiten von einem zentralen Erschließungsbereich wegstreben, sodass zwei großzügige, begrünte Außenräume entstehen. An der vierten Seite dockt locker der Eingangs-, Therapie- und Verwaltungstrakt an, sodass auch hier vernünftige Außenräume entstehen, auch wenn sie auf der Ankommensseite der Parkierung und teils als Wirtschaftshof dienen.
Jahreszeiten, Jahresringe
Dieses Ausgreifen und Verzahnen mit dem Umraum bietet jenen, die noch einigermaßen gut zu Fuß sind, aber auch jenen, die im Rollstuhl geschoben werden müssen, eine Möglichkeit für kleine Spaziergänge, ohne mit Autos in Konflikt zu kommen. Zugleich erlaubt der Blick aus den Zimmern, der durch die französischen Fenster auch für bettlägerige Bewohner leichter möglich ist, den Wechsel der Jahreszeiten am wachsenden und welkenden Grün mit zu verfolgen. Natürlich wird es noch ein paar Jahre dauern, bis sich der kleine Park entwickelt hat, aber auch dieser Vorgang bietet Anregung.
An der Fassade wechseln große Fensterflächen, vor denen flache Balkone angeordnet sind, mit holzverschalten Elementen, hinter denen sich in den Zimmern erkerartige Nischen befinden, die seitlich verglast sind, sodass auch diagonale Ausblicke möglich sind. Die klaren Proportionen verleihen der Fassade und damit dem ganzen Gebäude Großzügigkeit und zugleich unverkennbare Identität. Das Holz wird mit den Jahren teils von der Sonne braunrot gebrannt werden, teils vom Regen grau verwaschen. Dies wird den Gesamteindruck weiter differenzieren und den individuellen Charakter der Außenräume stärken.
Besuchende betreten das Gebäude von der Rückseite, nachdem sie es – wahrscheinlich mit dem Auto – umrundet haben. Die kleine Eingangshalle wird von einer großflächigen grafischen Arbeit von Erich Steininger stark aufgewertet, die als frei stehender Wandschirm die Bewegungen der Menschen leitet: nach links zu den Pflegeabteilungen, nach rechts in den Verwaltungstrakt. Ein Café, ein Frisiersalon und die Kapelle schließen an. Geradeaus geht es Richtung Pflegebereich, vorbei an den Aufzügen und der Treppe, die alle drei Stockwerke und das Untergeschoß bedienen.
Prinzipiell sind die Hauptgeschoße ähnlich organisiert. Als Erstes gelangt man in eine großzügige Aufenthaltszone, von der keilförmig sich verjüngende Stichgänge in die drei Zimmertrakte führen. Mauerscheiben wechseln mit flachen Nischen, in denen sich die Türen zu den Zimmern befinden. Durch diese raumplastische Gliederung in Querrichtung verliert der Gang den Zug in die Länge, und das keilförmige Zusammenlaufen lässt ihn – vom Aufenthaltsbereich her – kürzer scheinen. Ein großes Fenster in der Stirnseite öffnet den Abschluss zum Licht.
Die Materialisierung unterstützt die differenzierende Raumbildung. Die Mauerscheiben bestehen aus horizontal geschaltem Beton, farbig gestrichen, sodass die Jahresringstruktur der Bretter noch zu erkennen ist. Ein dunkles Ziegelrot, ein Sonnengelb und ein freches Grün unterscheiden die drei Gangräume klar. Das Streichen der Oberflächen in kräftigen Farben wirkt jedoch dematerialisierend und betont das Abbild des Holzes. Die Türnischen sind vertikal in schlichtem Holz furniert, und der Fußboden ist mit Linoleum ausgelegt.
Die Decke ist wieder aus Holz. Wie das, wird man fragen, wenn die tragenden Mauern offensichtlich betoniert sind? Es sind Brettsperrholztafeln, die schubfest mit einem Überbeton verbunden sind, sodass Holz und Beton tragend zusammenwirken. Dies bringt Vorteile in akustischer Hinsicht sowie bezüglich Durchbiegung und Schwingungen. Optisch erweist sich jedoch die sichtbare Holzdecke als großer Gewinn, da sie wohnlicher wirkt als weißer Gipskarton oder Putz. In den Zimmern ist dies gewiss noch wichtiger, denn Bettlägerige haben nicht viel Auswahl, wohin sie schauen können, und eine Holzdecke wirkt eben lebendiger. Folgerichtig sind keine Leuchten an der Decke angebracht. Das künstliche Licht kommt indirekt aus einem Deckenversatz, sodass Blendung vermieden wird.
Dennoch darf man sich auch bei der Bauaufgabe für ein Pensionistenheim nicht zu viele Illusionen machen. Die Kosten dürfen nicht in den Himmel schießen, Hygiene und Pflegefreundlichkeit gilt es sicherzustellen, und funktional im Sinne des Personals sollte der Betrieb auch sein. Jahrzehntelang folgten diese Häuser denn auch in der Erscheinung dem Vorbild von Spitälern – von deren raumgestalterischen Qualitäten wir hier absehen wollen –, dabei handelt es sich um Wohnheime mit intensiver Betreuung. Diesen Anforderungen haben sich Architekten erst in jüngster Zeit ernsthaft gestellt, da die funktionalistischen Maximen der Moderne immer noch nachwirkten.
Der Wert der späten Jahre
Mit dem Landespensionistenheim in Waidhofen an der Thaya hat Gerhard Lindner eine äußerst positive Antwort auf die anspruchsvolle Bauaufgabe gegeben. Es gelang ihm, den Klinikcharakter zurückzudrängen. So könnte beispielsweise der Pflegestützpunkt durchaus als Verkaufspult für eine Konditorei durchgehen, ohne dass ein direktes Vorbild strapaziert würde. Und die hölzernen Handläufe entlang türloser Wände sind nicht bloß praktisch, sondern wirken achtsam und damit wohnlicher.
Allein, dass Verlassen eingespielter Muster fordert von allen Beteiligten einiges an Denkarbeit und Akzeptanz. Denn kann etwas, das auf den ersten Blick nicht so aussieht, hygienisch, funktional und leicht zu reinigen sein? Es kann sehr wohl, denn die technischen Möglichkeiten haben auch hier neue Wege geöffnet, und wenn die fixen Bilder in den Köpfen gelockert sind, wird manches möglich. Und plötzlich gewinnt das Wohnen für die abschließenden Monate oder Jahre eines Menschenlebens einen anderen Wert.
Man verbindet ihn eher mit Zweckbauten und feuchtkalten Durchgängen: Beton kann aber auch farbig sein oder textil wirken. Eine Mustersiedlung in Wien ist dem Baustoff gewidmet – und hat nichts zu verstecken.
Ein sanfter Südwesthang über dem Wienfluss, vorstädtische Lage im äußersten Westen Wiens, Busstation vor der Nase und Schnellbahnstation um die Ecke. Da nimmt man die Bahnlinie davor und die Verzweigung Aufhof in Kauf. Jedenfalls überstieg das Interesse das Angebot etwa um das Zehnfache. Und gegen Luftschall ist der Beton unter den Baustoffen das Mittel der Wahl. Doch das war bloß ein Nebenargument, denn das Ziel dieser Mustersiedlung lautete, die Möglichkeiten des Baustoffs Beton „nachhaltig wirksam“ darzustellen. Darstellen heißt – auch – sichtbar machen, was heute aufgrund der erforderlichen Dämmwerte etwas mehr geistige Leistung erfordert als in den ölseligen Jahren vor 1973. Doch das sind bewältigbare technische Aspekte. Das eigentliche Problem ist die Anmutung.
Unsichtbar kommt Beton in fast allen Häusern vor. Auch Ziegel- und Holzbauweise können kaum darauf verzichten. Doch Herzeigen ist eine anspruchsvollere Aufgabe, denn sichtbar präsent ist Beton vor allem bei Tiefbauten der technischen und Verkehrsinfrastruktur, am unangenehmsten wohl in feuchtkalten Straßen- und Bahnunterführungen, während er bei Brücken, Tunnels und Stützmauern oder bei Tiefgaragen, Industrie- und Versorgungsbauten selbstverständlich erscheint. Das Problem lautet daher nicht, wie gewöhne ich die Menschen an den Tiefbaubeton, sondern: Wie wird Beton architekturfähig, sodass er auch im Wohnungsumfeld Anklang findet. Dies sollte mit einer Mustersiedlung demonstriert werden. Mit der Wahl von neun Architekten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, die ihre Kompetenz im Beton- wie im Wohnbau bereits ausreichend bewiesen hatten, durfte die Trägergruppe, angeführt von Lafarge Perlmoser, auf ein achtbares Resultat hoffen. Weiters sollten die Siedlungen nach den Auflagen für geförderten Wohnbau errichtet werden, wofür sich das Österreichische Siedlungswerk und die Gesellschaft für Stadtentwicklung und Stadterneuerung zur Bauträgerschaft zusammenfanden.
Grundrisse bestechend großzügig
Die „Spielleitung“ für das ambitiöse Unternehmen übernahm der in Berlin lehrende Wiener Architekt Adolf Krischanitz. Die Begrünung der Außenräume wird nach den Ideen der Landschaftsarchitektin Anna Detzlhofer heranwachsen. Mit einem vergleichsweise rigiden städtebaulichen Konzept strebte Krischanitz eine Ordnung an, die bei den zu erwartenden individuellen Konkretisierungen der einzelnen Gebäude dennoch einen Zusammenhalt garantierte. So stehen nun in zwei Kolonnen zehn prinzipiell längliche, dreigeschoßige Quader parallel zum Hang. Während die Längsseiten sich relativ nahe kommen, verfügen die Stirnseiten über mehr Luft, indem sich zwischen den beiden Häuserkolonnen ein Anger den Hang hinaufzieht und an den Seiten der Straßenraum zum Abstand von den Nachbarhäusern beiträgt. Funktional lässt sich dies mit der von Süden steiler einfallenden Sonne begründen. Wie zu erwarten, sind die Häuser sehr individuell geraten. Sei es aufgrund der Möglichkeit, Beton mit heutigen Technologien architektonisch vielfältig einzusetzen, oder sei es wegen des reichhaltigen Wohnungsangebots.
In vorderster westlicher Position steht das von Peter Märkli, Zürich, entworfene Haus. Der immer schon eigenständige Schweizer hat den Baukörper durch einen Versatz und die Betonung der Geschoßdecken stark plastisch akzentuiert. Die Fugen der Schalungselemente gliedern in zurückhaltender Weise die Mauerflächen. Die Wohnungsgrundrisse entwickeln sich in diagonaler Raumfolge vom offenen Treppenhaus an der Nordecke bis zur Loggia an der Südecke in bestechender Großzügigkeit. Wie bei allen Häusern mit Sichtbetonfassade besteht die Wärmedämmung an der Innenseite aus geschäumtem Glas.
Ostseitig steht zuvorderst ein blockhafter Bau mit betonten Ecken von Adolf Krischanitz. Verputzte Flächen und solche aus Sichtbeton gliedern das Bauwerk, dessen eher kleine Fenster und eingezogene Loggien an den Stirnseiten an der exponierten Lage dem Schallschutz Rechnung tragen. Die jeweils zwei Wohnungen pro Geschoß verfügen beidseits der zentralen Wohnhalle über flexibel zuordenbare Räume.
In der zweiten Reihe fällt der historisierende Bau von Hans Kollhoff, Berlin, in blendendem Weiß auf. Die vier Maisonnette-Wohnungen sind geschoßweise verschränkt, sodass alle vier Wohnungen Anteil an den beiden Stirnseiten haben. Das Thema Beton tritt allerdings hinter der Fassade zurück. Die Stuckelemente enthalten jedoch als Bindemittel Zement.
Das Nachbarhaus in der zweiten Reihe stammt von Otto Steidle, München. Nach dessen überraschendem Tod hat Johannes Ernst die Arbeit abgeschlossen. Dieses Haus ist von der inneren Organisation beachtenswert und belegt die hohe Kompetenz Steidles für den Mehrwohnungsbau. Vier Reihenhäuser stehen im Erd- und im zweiten Obergeschoß wie üblich nebeneinander. Im ersten Obergeschoß wechselt die Unterteilung in längs und einmal quer, sodass jeder Wohnung eine Zimmerzeile bis zur Gebäudeecke zugeteilt wird. Die geschützte Dachterrasse im obersten Geschoß vervollständigt den hohen Wohnwert. Die Sichtbetonfassade wird mit Fenstern und Schalungsfugen sparsam, aber sorgfältig proportioniert.
In der mittleren Reihe haben die Zürcher Gegenklassiker Marcel Meili und Markus Peter sowie der verhalten klassisch agierende Roger Diener aus Basel gearbeitet. Erstere zeigen mit einem diagonal sich entwickelnden Grundriss ihre raumgestalterische Kompetenz. Beim Beton spielen sie mit der Einfärbung der Gussmasse, wobei die willkürliche Grenzziehung technisch sehr anspruchsvoll war. Eine dritte geplante Farbe hätte den Kostenrahmen gesprengt. Roger Diener gibt jeder Einheit einen eineinhalb mal höheren Wohnraum und erzielt an der Fassade durch seitlich mit einer Fase versehene Schalbretter einen feinen, nahezu textilen Effekt.
Die nächste Reihe teilen sich Heinz Tesar und Max Dudler, Berlin. Tesar gliedert das Volumen in vier doppelgeschoßige Einheiten, die räumlich und bezüglich der Öffnungen eine hohe Qualität bieten.
Kabinettstücke des Wohnbaus
Den Sichtbeton hält er glatt und flächig und kontrastiert ihn mit einzelnen großen Fenstern, die den Fassadeneindruck dominieren. Dudler arbeitet mit dunkelgrau eingefärbtem Beton und vorgefertigten Elementen. Der stark ornamentale Charakter der Fassade mit schmalhohen Fenstern birgt jedenfalls brauchbare, zu den Stirnseiten orientierte Grundrisse.
Zuhinterst steht ostseitig das von Hermann Czech entworfene Haus, der auf die Hanglage mit einem feinen Raumplan antwortet und den Quader mit Versätzen und Terrassen auflöst. Unbekümmert bringt er die verputzte Dämmung außen auf und zeigt Rohbeton im Inneren. Westseitig ersetzt der oberste Baukörper drei Einzelhäuser des ursprünglichen Konzepts. Adolf Krischanitz hat hier kompensatorisch einen äußerst kostengünstigen, aber nicht minder durchdachten Entwurf realisiert. Insgesamt ist es sicher gelungen, eine breite Palette architekturfähiger Ausdrucksweisen in Beton zu realisieren. Darüber hinaus entstanden jedoch mehrere Kabinettstücke des Wohnbaus von außerordentlicher Qualität.
Ein Großteil des heutigen Architekturschaffens zeichnet sich durch glatte, harte Oberflächen aus, die sich gegen sinnliche Annäherung spreizen. Sie wollen vor allem sich selber zeigen, aber nicht angegriffen werden. Glauben ihre Entwerfer, sie könnten sie unangreifbar machen?
Seit einiger Zeit taucht bei der Anpreisung von Bauten oft der Begriff „Kristall“ auf. Das Bedeutungsfeld dieses Begriffs wird mit den Eigenschaften hart, transparent, klar, strahlend, rein, geometrisch und geordnet bis in die Molekularstruktur aufgespannt. Mit dem Schlagwort Kristall wird die Vorstellung eines Idealzustands aufgerufen, die sich auf das bezeichnete Objekt übertragen soll. Wie immer in solchen Fällen gibt es einige befriedigende und zahlreiche schlechte Beispiele. Das Kristallhafte, das einen idealen Zustand beansprucht, wird bereits durch kleine Unregelmäßigkeiten verunreinigt, ganz zu schweigen von Mängeln oder Fehlern. Der Kristall – in der Architektur – ist ideomorph, herrisch und duldet keine Konkurrenz. Wer nach ihm greift, muss sich seinen Gesetzen unterwerfen und hat meistens schon verloren. Daher gibt es so viele missglückte „Kristalle“, die das hehre Wort abnützen.
Der Kristall ist eitel, will zeigen, dass er allseitig ideal ist und kennt keine Rückseite, überall ist vorn. Was das für ein Gebäude bedeutet, lässt sich vielleicht am Problem erahnen, wo und wie man denn in einen Kristall hineingelangt, ohne den idealen Ausdruck zu stören und damit zugleich zu zerstören. Das Ganze erinnert ein wenig an die Schwierigkeiten, die sich ein Architekt einhandelt, wenn er einen Zentralbau entwerfen will, wie ein Blick in die Architekturgeschichte belegt. Nur wenige sind geglückt, die meisten weisen da oder dort Anzeichen auf, wie mühsam es war, die Ansprüche des Typs und jene der Nutzung in Einklang zu bringen, dass die idealtypische Konkurrenzierung leider doch nicht ganz gelang, weil eine Treppe, ein Zugang, ein wichtiger Ort im Gebäude oder eine Toilette das Idealbild stört. Nicht anders verhält es sich beim Gebäudetyp „Kristall“. Es reicht nicht, ihm den klingenden Namen umzuhängen, die Aufgabe ist entwerferisch und in der Baudurchführung zu lösen, sonst wird es peinlich.
Nun gut, dann eben kein idealer Kristall, aber ein wenig Kristall, besser „kristallin“, müsste doch erlaubt sein. Exakt diese Praxis breitet sich seit Jahren aus. Die Oberflächen sind glatter, härter und spiegelnder geworden. Glas, Metall, polierter Stein bestimmen außen und innen die neuen Gebäude. Glätte bedeutet Abkehr vom haptischen Charakter der Materialien. Sie sollen nicht „begriffen“ werden, nur gezeigt und gesehen. Gesehen, wie auf den auf Hochglanz gedruckten Abbildungen. Die primäre Erfahrung ist nicht mehr das Material selbst, sondern dessen Abbild. Dieses Bild soll vom Objekt wiederholt werden. Daher nicht berühren. Weil die Teile meistens kalt sind und ihrer Glätte die Feinstruktur fehlt, lässt sich vom Griff nicht mehr auf das Material schließen. So könnten wir auf den Tastsinn verzichten und dicke Fäustlinge anziehen.
Die glatten Oberflächen spiegeln das Licht, es wird vervielfacht und blendet bald einmal. Macht nichts, dann wird eben alles andere schwarz. Kristallin blendend – nicht bloß weiß – und schwarz. Keine Graustufen, das wäre peinlich kompromisslerisch. Aber: Warum ohne Not auf das breite Feld der Zwischentöne verzichten, etwa weil es Arbeit bedeuten könnte – interessante, inhaltlich bereichernde Arbeit, Forschung sogar?
Die glatten und harten Oberflächen bergen ein weiteres Problem: Da sie schallhart sind, ist der Nachhall lang und die Raumakustik schlecht. Die Sprachverständlichkeit sinkt, die Menschen müssen lauter reden, der Schallpegel steigt und so weiter und so fort. Wer kennt nicht die Lokale, in denen das eigene Wort nicht mehr verstanden wird, geschweige jenes des Gesprächspartners, der -partnerin. Macht nichts, denn sie telefonieren sowieso die halbe Zeit.
Kann es sein, dass das gestalterische Prinzip des Kristallinen in den Händen von Halbgebildeten – denn Architekten, die sich von den historischen Erfahrungen ihres ureigensten Handwerks abgekoppelt haben, sind halbgebildet –, dass dieses Prinzip, oberflächlich umgesetzt, sich nur mehr an gleichsam fühllose, blinde und taube Menschen richtet, denen es reicht, wenn sie das Bild sehen und abnicken können: „erkannt“, ohne zu merken, dass ihnen das Wesen von Architektur vorenthalten bleibt? Zum Kosmos der Architektur werden sie so nicht vorstoßen. Die blendenden Oberflächen behindern eine klare Sicht, dahinter gibt es kein Dahinter, das mit Architektur etwas zu tun hätte.
Klassizität als Stand einer Architekturentwicklung ist nicht zuletzt dann erreicht, wenn der Ausdruck eines Bauwerks das Gemachtsein vergessen lässt. Wo die Qualitäten der Formen, Proportionen und Oberflächen jenen Grad erreichen, der das Wesen des Werks in den Vordergrund bringt. Damit aber der profane Charakter eines Materials vergessen werden kann, muss es Hinweise auf diesen Charakter, zumindest eine Erinnerung an seine Materializität geben. Diese Erinnerung verblasst jedoch zusehends wegen der Verbreitung überglatter Materialien und durch das Überhandnehmen von Bildern glatter, wesenloser Oberflächen, wie sie nicht zuletzt von der Werbung geliebt werden.
In solchen Zeiten der Übersättigung mit gedankenlosen, sich selbst reproduzierenden Nachahmungen kam es im Verlauf der Geschichte und kommt es auch heute zu gegenklassischen Bewegungen, die, zuerst tastend und kaum bemerkt, etwas anderes suchen und versuchen. Zu nennen sind etwa die architektonischen Forschungen von Rüdiger Lainer zum Ornament und zur „Tiefe der Oberfläche“, die Arbeit an der expressiven Plastizität von Bauwerken und ihrer materialen Kraft durch Marie-Therese Harnoncourt und Ernst J. Fuchs, aber auch die primären Erfahrungen, die Architekturstudentinnen und -studenten der TU Wien, der Kunstuniversität Linz und anderer beim Bauen in Südafrika oder Bangladesch mit ortstypischen Materialien machen konnten. Die Spannweite solcher Erfahrungen sollte breit sein: etwa vom samtigen Anfühlen einer zweimal täglich feucht abgewischten Oberfläche eines feinporigen Naturholztisches bis zu jener Tatsache reichen, wie leicht man sich an splittrigem Holz einen Schiefer einzieht.
Wissen gehört auch dazu. Kulturgeschichtliche Kenntnisse, die den Bedeutungshintergrund von Materialien anreichern und verdichten, helfen zu unterscheiden, ob bei einer Filialkirche Stein aus dem gleichen Bruch verwendet wird, der dem Bau des Stephansdoms diente, oder ob der Stein in eine Bar kommt. Dafür ist Forschungsarbeit zu leisten, weil nicht nur alte Muster kopiert werden sollten oder weil die historischen Traditionen verschüttet sind, aber zugleich heutigen Ansprüchen nicht mehr genügen würden. Handwerkskunst und praxisbezogene Ingenieurwissenschaft sind dabei wichtiger als formalistische Experimente. Allerdings kann das heute der einzelne Architekt nicht allein bewältigen. Er braucht Partner, die ihr Metier beherrschen, was für den Architekten ebenso gilt. Dabei ist weniger wichtig zu wissen, was man meint zu können, weil sich das schnell ändern kann. Entscheidender ist zu wissen, was man nicht kann, damit die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachleuten frühzeitig einsetzt. Andernfalls muss man sich hinterher mit dem Glätten der Oberflächen begnügen.
Eine preisgekrönte Diplomarbeit, Wasserbüffel statt Mischmaschinen und eine deutsch-österreichische Pionierleistung: der Bau einer Schule in Bangladesch. Ein Stück Hilfe zur Selbsthilfe.
Margarethe Schütte-Lihotzky-Stipendium 2005: Der Jury liegt ein Heft vor über das Projekt für ein kleines Schulgebäude in Bangladesch. Es war Thema einer von Roland Gnaiger, Leiter der Fachklasse Architektur der Kunstuniversität Linz, betreuten Diplomarbeit. Illustriert ist es mit Handzeichnungen in Blei- und Buntstift und ergänzt mit Erläuterungen in einer energischen, gut lesbaren Handschrift. Aber wir schreiben doch das Jahr 2005, wo bleiben Computereinsatz und innovative Materialien? – Die wollen dort bauen, nur mit Lehm und Bambus. Und die Schule soll in einem der ärmsten ländlichen Gebiete errichtet werden, mit Materialien, die am Ort verfügbar und absolut günstig sind. Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe, das wäre im Sinne der Namensgeberin des Stipendiums. Klar, einstimmig dafür.
Die Stipendiatin, Anna Heringer aus Rosenheim, frisch diplomierte Absolventin der Architektur, ist im Spätherbst desselben Jahres wieder in Rudrapur, Bangladesch, das sie von einem freiwilligen Sozialjahr Ende der 1990er-Jahre und weiteren Reisen gut kennt. Ihr Entwurf wird unter ihrer Leitung mit dem Berliner Architekten Eike Roswag sowie dem Bauingenieur und Lehmbauspezialisten Christof Ziegert und weiteren Helfern zusammen mit örtlichen Handwerkern und angelernten Kräften gebaut. Die Lehmbautechnik, deutsch: „Wellerwand“, ist auf die örtlichen Verhältnisse abgestimmt. Wasserbüffel stampfen im Kreis den Brei aus Lehm und Stroh.
Es wird in „Sätzen“ von zirka 60 Zentimeter Höhe gearbeitet, indem die Strohlehmmischung in mehreren Lagen, ohne Schalung aufgebracht wird. Nach einer Woche ist das Material so weit trocken, dass die endgültige Mauerstärke entlang von Richtlatten mit flachen Spaten abgestochen werden kann und die vorher struppige Oberfläche vergleichsweise glatt wird. Dann folgt der zweite Satz nach demselben Prinzip, dann der dritte – wenn nicht der subtropische Regen das Arbeiten verzögert. Die Schulkinder fertigen inzwischen unter Anleitung der Lehrer die Überlager für Türen und Fenster: Mit Stroh-Lehm-Zöpfen umwickelte Bambusstangen, die, nebeneinander gelegt, die Öffnungen überbrücken, sodass darüber die Lehmmauer weitergeführt werden kann.
Bauen mit Lehm ist weltweit verbreitet. Auch in Europa war es vor Jahrhunderten gang und gäbe. Das deutsche Wort „Wand“ kommt vom „Winden“ der Stroh-Lehm-Zöpfe auf meist dreikantige – noch gespaltene, nicht gesägte – Hölzer, die dicht übereinander in die Felder des Fachwerkskeletts eingesetzt waren. Danach wurde mit Lehm verputzt und mit Kalkfarbe gestrichen. Lehmmauern und -verputze finden auch heute wieder Anhänger. Pionierarbeit leistete der Vorarlberger Martin Rauch, der die Diplomandin beriet und in der Linzer Architekturschule lehrt. Bei der Detailplanung und Ausführung war der Bauingenieur Christof Ziegert aus Berlin beteiligt, der die Bautechnik und das Verfahren für die örtlichen Gegebenheiten definierte – beispielsweise ohneden Einsatz kostspieliger Schalungen.
Die Kooperation mit der Technischen Universität Berlin betraf aber auch den Bambusbau, denn eine Decke und ein Dach einer Bambuskonstruktion, in der Schüler sich aufhalten, müssen so sicher sein wie jede andereKonstruktion auch. Der Bauingenieur Uwe Seiler half bei der Entwicklung und leitete Versuche mit einem drei Meter großen Deckenfeld und mit Trägern aus mehreren Bambusstäben. Die zur Ausführung bestimmte Konstruktion hat er berechnet: Drei Lagen kräftiger Bambusstäbe bilden einen Trägerrost, wobei die mittlere Lage quer liegt. Alle Knoten wurden mit Stahlstäben verdübelt und mit Nylonschnüren gebunden. Zwischen die oberste Schicht tragender Bambusstangen wurde eine Schalung aus Bambusmatten gelegt, der Boden aus Strohlehm aufgebracht und geglättet.
Angeleitet von Zimmermann Emmanuel Heringer, konnten in der Zwischenzeit die zahlreichen Rahmen der Obergeschoßkonstruktion aus Bambus an einem Lehrgerüst vorgefertigt werden. Überhaupt wurde der technisch-handwerklichen Weiterbildung derheimischen Handwerker und Hilfskräfte viel Beachtung geschenkt, denn diese sollen die erlernten Fähigkeiten eigenverantwortlich einsetzen können. „Jeder lernte viel von den anderen. Ich lernte, starke Mauern zu bauen und Messinstrumente zu benützen. Und die Fremden lernten, dass Wasserbüffel die besten Mischmaschinen sind,“ berichtet der Lehmhandwerker Suresh.
Bauträger ist die in der Region tätige NGO Dipshikha, die das für den ländlichen Raum entwickelte Konzept der METI-Schulen (Modern Education and Training Institute) fördert. Damit soll der ländlichen Bevölkerung der Zugang zu guter, ganzheitlicher Bildung ermöglicht und der allgemeine Standard gehoben werden. Die Absolventen der zwei Vorschul- und acht Schuljahre sollen den Bezug zum Dorf nicht verlieren und die erworbenen intellektuellen und handwerklichen Fähigkeiten für die Entwicklung des ländlichen Raumes einsetzen.
Das Schulgebäude ist denkbar einfach: Im Erdgeschoß teilt das offene Treppenhaus den Baukörper in zwei und ein Klassenzimmer, an deren Rückseite je ein in weichen Rundungen aus Lehm ausgeformter, höhlenartiger Rückzugsraum anschließt für individuelles Studium oder Kontemplation. Die Lehmwände schützen vor Aufheizung durch die Sonne. Das Obergeschoß ist ein Leichtbau aus Bambus, beschattet und beschirmt durch das ausladende Dach. Bambusmatten halten die Sonne ab, lassen aber die Luft durchstreichen, sodass das Klima in den Schulräumen angenehm ist.
Das Arbeiten mit Menschen am anderen Ende des Globalisierungsprozesses ist nicht weniger anspruchsvoll. Fachliche und soziale Kompetenz sind ebenso gefordert, und der Kostendruck ist genauso vorhanden. Allerdings ist der Optimierungs-Effekt sowohl menschlich als auch hinsichtlich der baulich-räumlichen Qualität ein Vielfaches höher als im übersättigten Mitteleuropa.
Neben weiteren Preisen und Auszeichnungen erhielt die Diplomarbeit von Anna Heringer kürzlich den dieses Jahr in Shanghai vergebenen Hunter Douglas Award der in Rotterdam domizilierten Archiprix Foundation für die weltweit beste Architektur-Diplomarbeit. Unter den 185 Einreichenden aus 62 Ländern waren Absolventen der renommiertesten Architekturschulen vertreten, und selbst sie favorisierten in ihrer Auswahl die „School-handmade in Bangladesh“. Mittlerweile arbeitet das Team an Wohnhäusern in der Nähe des Schulhauses. Aus Lehm natürlich, und als Mutserbauten zur Verbesserung der Wohnverhältnisse.
[ Kunstuniversität Linz, die Architektur, Leitung: Roland Gnaiger; Energieberatung: Oskar Pakraz; Lehmbau: Martin Rauch. Technische Universität Berlin, Studienreformprojekt Foreign Affairs.
Team: Anna Heringer, Eike Roswag (Ar-chitekten), Christof Ziegert, Uwe Seiler (Bauingenieure), Emmanuel Heringer, Stefanie Haider (Bambuswerk, Metallbau). ]
Selbstbewusst und dennoch uneitel fügt sich die Freilicht-Konzertanlage in den Schloss- park von Grafenegg: der „Wolkenturm“, ein Werk der Sorgfalt und des plastischen Gespürs.
Einer Insel gleich liegt der Schlosspark von Grafenegg in der Weite landwirtschaftlich genutzter Flächen, gesäumt von einer niedrigen Mauer, die vom alten Baumbestand überragt wird. Von Weitem war seit jeher der Turm der neogotisch überformten Schlossanlage zu erkennen, die im Kern gotische sowie Elemente der Renaissance aufweist. Etwas weniger fernwirksam, aber durchaus spektakulär ist nun ein Element des 21. Jahrhunderts dazugekommen: die Freilichtkonzertanlage. Sie liegt östlich des Schlosses in einer Geländevertiefung – „große Senke“ geheißen – die im 2005 abgehaltenen Wettbewerb als Standort festgelegt war.
Besonders daran sind nicht nur die betrieblich optimalen Voraussetzungen für Orchester und Zuhörer, es ist auch nicht allein die ausgewogene, von Müller-BBM, München, betreute Akustik; vielmehr sind es wahrnehmungsästhetisch die von „the next ENTERprise - architects“ mit architektonischen Mitteln erzielte Integration in den Park und zugleich die Verselbstständigung zum Bauwerk im Park, welche die neue Anlage auszeichnen. Im künftigen Dreieck: Schloss, Reithalle/Konzertsaal/Taverne, Freilichtbühne wahrt Letztere trotz ihrer expressiven Kraft jene Angemessenheit, die wirklich guter Architektur eigen ist. Die Entwerfenden wussten um die mittlere Rolle im Kontext und füllten sie selbstbewusst, aber uneitel aus.
Obwohl das Objekt von Weitem zwischen den Baumkronen zu erkennen ist, erscheint es Besuchern, nachdem sie vom Parkplatz durch das alte Tor in der Mauer gelangt sind, vorerst eher geheimnisvoll, da es in der Senke und hinter einem Rasenwall fast – aber eben nur fast – verschwindet. Auf dem kurzen Weg in den Park hinein darf man sich nach der Autofahrt – auf dem Land bleibt das Automobil Hauptverkehrsmittel – die Beine etwas lockern; lateral wird man hingeführt und gelangt auf ein Vorfeld mit wassergebundener Decke, von dem zwei von Stahlbetontafeln flankierte Schneisen durch den Rasenwall führen. Ein wenig erinnert der Beton zuerst an Straßenunterführungen; dieses Anklingen ist Absicht, wird aber von der Formgebung der plastischen Elemente aus dem „gewöhnlichen“ Material gekonnt überspielt. Nicht nur, dass die Flächen geböscht und schräg im Raum – geometrisch gesprochen: windschief – zueinander stehen, sondern auch die Schmalseiten schließen nicht orthogonal ab, sie sind schräg abgeschnitten und weisen exakte Kanten auf. Damit werden Körperhaftigkeit und Masse der Elemente betont, und es wird über eine anspruchsvolle Detailgestaltung subtil Abstand zum ordinären Tiefbau gewonnen. Die Erfahrungen vom Seebad Kaltern mögen eingeflossen sein, jedenfalls hat der Südtiroler Tragwerksplaner Josef Taferner, aus dem Ingenieurteam Bergmeister in Vahrn, auch hier wieder mitgewirkt.
Obwohl wir noch gar nicht am Ort des Geschehens sind, sondern noch in den Zugängen, bringt das Durchschreiten des Rasenwalls ein erstes intensives räumliches Erlebnis. Die Besucherströme werden gleichsam durch Kanäle gespült, die dem Einlauf zu einem Kleinkraftwerk alle Ehre machen würden. Einmal in der Arena angelangt, ob auf halber Höhe oder in der Tiefe der Senke vor der Bühne, steht man vor dem Objekt, das die Architekten bereits im Wettbewerb „Wolkenturm“ nannten.
Das atektonische Gebilde aus tafelartigen und gekanteten Betonkörpern, mit Rippen verstärkten Stahlplatten, verglasten Durchbrüchen und einer dematerialisierend mit walzblankem Blech verkleideten obersten Leichtbaukonstruktion entwickelt sich aus der Senke heraus, ohne dass es architektonische Hinweise gäbe, was wie trägt; aber gerade das macht die Elemente gewichtslos, gibt ihnen architektonisch den Auftrieb zum diffusen Schweben, das den Namen Wolkenturm rechtfertigt.
Die Sitzreihen für die 1670 Plätze steigen aus der Senke und legen sich an den polygonal geformten Rasenwall, von dessen Scheitel der Ausblick auf Bühne, Park, Reithalle/Konzerthalle und zum Schloss wandert, das neben einer Baumgruppe sichtbar wird. Diese Blickbeziehung ist wesentlich, denn die Frage, wie das neue Objekt im Park vom Schloss aus wirken würde, war dem Hause Metternich-Sándor als Eigentümer schon beim Wettbewerb wichtig. Nun steigt die Wiese aus der Ebene des Parks rückenartig leicht an, daraus entwickelt sich eine schräg nach oben gestaffelte Dynamik plastischer Beton- und Stahlelemente, die in dem unregelmäßigen, scharfkantig-spitzwinkligen Körper über der Bühnenöffnung kulminiert. So zeigt sich das Bauwerk von jeder Seite – und davon gibt es mehr als vier – in veränderter Gestalt. Es nimmt Bezug auf den Park und ist eine seiner optischen Attraktionen, denn dieser ist ganzjährig offen, Musikanlässe beschränken sich vorerst auf einige Wochen und einzelne Tage.
Neben dem Standort für hochwertige Konzertdarbietungen, der mit dem voraussichtlich im Frühjahr 2008 fertiggestellten Konzertsaal neben der frühklassizistischen Reithalle weiter ausgebaut wird, ist der 31 Hektar weite Park, eine überregional bedeutende Anlage, einen Besuch wert. Seine Geschichte spiegelt jene des Schlosses. Barocke Rudimente finden sich eingestreut in einem englischen Landschaftsgarten des 19. Jahrhunderts mit zahlreichen Strauch- und Baumarten. Während im 20. Jahrhundert die gestalterischen Ambitionen begrenzt blieben, wurde in jüngster Zeit die lebende dendrologische Sammlung – eine Vielzahl verschiedener Baumarten – ausgebaut. Zusammen mit next ENTERprise gewann das Büro „Land in Sicht“ des Landschaftsarchitekten Thomas Proksch den Wettbewerbsteil „gartendenkmalpflegerische Erneuerungdes Parks“. Das Konzept sah eine sanfte und naturnahe Pflege und vorsichtige Erneuerung vor. Mehrere alte Wege durchziehen den Landschaftsgarten und ermöglichen kürzere und längere Spaziergänge. Wie immer wird es ein paar Jahre dauern, bis alle Maßnahmen sich entfaltet haben und die Pflanzen herangewachsen sind. Da die Substanz reichhaltig war, ist der Park in Grafenegg neu angelegten Anlagen gegenüber im Vorteil und schon jetzt äußerst attraktiv.
Die außerordentliche Sorgfalt, mit der die Konzertanlage in den Park integriert und die Topografie des Ortes gestaltet wurde, macht sie zu einem begehbaren Architekturobjekt, das seinen Sinn aus der räumlichen Erfahrung, die es bietet, gewinnt und damit in vermeintlich toter Zeit belebend wirkt. The next ENTERprise - architects, das sind Marie-Therese Harnoncourt und Ernst J. Fuchs und ihr Team, demonstrieren damit ein weiteres Mal ihre Kompetenz und ihr plastisches Gespür. Der wiedererwachte Expressionismus mag seine Wurzeln in den frühen 1920er-Jahren haben, damals wurde jedoch mehr gezeichnet als gebaut. Heute sind es „tnE“ und andere, die bauen, und zwar in nachhaltiger Qualität. Da man hört, was man sieht (alte Akustikerregel) dürften die Konzerte fulminant werden.
Kaltern in Südtirol. Ein Platz wie aus dem Lehrbuch und daran ein offenes Kunstwerk von Hermann Czech: das Weinhaus Punkt. Eine subtile Mischung aus Bestand, Ordnung, Vorläufigem und schwer datierbaren Zutaten.
Auf der Alpensüdseite weisen nicht wenige dörfliche Siedlungen in ihrem Kern einen urbanen Charakter auf, auch wenn die landwirtschaftliche Produktion – neben dem Tourismus – wesentlich ist. Als Marktgemeinde verfügt Kaltern in Südtirol mit dem Markt seit Langem über dessen urbanisierendes Potenzial. Zudem haben sich seit dem 16. Jahrhundert zahlreiche Adelige und Notabeln im Ort „Ansitze“ errichten lassen, eine Art herrschaftlichen Zweitwohnsitz, der seinerseits städtische Muster in den schön gelegenen Ort einbrachte.
Doch ohne öffentlichen Raum kein Markt. Der entsprechende Platz liegt an der Hauptgasse. Er ist rechteckig, seine untere Stirnseite wird vom Rathaus eingenommen, dessen symmetrische Fassade das Vorfeld über die Straße hinweg dem Platz zuordnet. An den Längsseiten fassen zwei Häuserzeilen den Platzraum, der hinten von je seitlich vorspringenden Volumen abgeschlossen wird, zwischen denen eine Gasse steil bergan führt. Ein Platz wie aus dem Lehrbuch: intelligent, stimmig, attraktiv. Die südexponierte Platzwand weist Arkaden auf, vor denen Gasttische und Sonnenschirme stehen, nicht anders als am Wiener Graben.
Das Haus an der vorderen Ecke der Arkadenzeile, seit über 100 Jahren in Gemeindeigentum, war Ende 16. Jahrhundert als Ansitz errichtet worden und weist Elemente der regionalen Spätrenaissance auf. Eine 2003/2004 erfolgte, gründliche Sanierung schuf in den Obergeschoßen Räume für die Musikschule mit einem Saal für Konzerte. Im Erdgeschoß und in den Kellern sollte ein gastlicher Ort einziehen, wo die einheimischen Weinproduzenten ihre Produkte präsentieren wollten.
Wie die gesamte Südtiroler Kulturlandschaft ist auch dieses Haus geprägt von einer weit zurückreichenden, wechselhaften Geschichte, die sich in der Bausubstanz verfestigt hat. Um damit sorgfältig umzugehen und einen Ort für Einheimische wie für Touristen zu schaffen, holte man bewusst den Architekten Hermann Czech aus Wien.
Scheinbar roh, unfertig – perfekt
Er griff durchaus da und dort kräftig ein, beließ aber zugleich manches in einem rohen oder unfertig scheinenden Zustand, an den manchmal perfekte Oberflächen anschließen,sodass eine dicht gewirkte und intelligent gemischte Komposition aus subtil ordnenden Eingriffen, bewusst Belassenem und schwer datierbaren Zutaten entsteht, die der Anschauung vieles bietet und zugleich die Freiheit eines offenen Kunstwerks beansprucht.
Im Erdgeschoß schließt hinter der Arkade ein Vorraum an, von dem der Weg gerade in eine Bar mit Theke und Stehtischen führt und weiter in einen Gastraum, der von einem großen Tisch bestimmt wird. Sowohl vom Vorraum als auch vom Gastraum führen Treppen in die beiden Gasträume im Keller, sodass Erschließungsalternativen möglich sind. Die meisten Räume weisen einfache Kreuzgratgewölbe auf, der kleinere Kellerraum eine roh gefügte Tonne.
In der Einrichtung finden wir Elemente in abgewandelter Form wieder, die von Hermann Czech bekannt sind: die Spiegel, die offen geführten Lüftungskanäle und die Leuchten aus einem gewerblichen Umfeld. Doch sind es nicht diese augenfälligen Dinge, die der Gestaltung ihren besonderen Charakter verleihen, sondern das, was anfangs gar nicht bemerkt wird, sodass erst mehrmaliges genaues Hinschauen zu Erkenntnis führt. Es sind dies beispielsweise die unprätentiöse Einrichtung hinter der Bar, die Anordnung der Toiletten beim Treppenabgang im großen Gastraum, die Gestaltung der Abgänge, die Disposition und Ausformung des großen Weinverkostungsraums im Keller sowie die Rolle der Oberflächen und Farben. Dabei kommen architektenhandwerkliche Kenntnisse und Erfahrungen zum Einsatz, die Hermann Czech wie nur wenige vielschichtig einzusetzen weiß, sodass ein komplexes Gewebe von teils durchaus widersprüchlichen Maßnahmen ein vorläufiges Gesamtbild ergibt, das von einem Vorher erzählt und ein Nachher nicht ausschließt.
Bei der Bar und ihrer Einrichtung wurde jede altarähnliche Stilisierung vermieden. Die Geräte und Regale sind nach betrieblichen Gesichtspunkten gereiht. Ihre scheinbar zufällige Anordnung berücksichtigt, dass Geräte einmal durch neue ersetzt werden und Regale weichen müssen, weil vielleicht neue Gläser größer sind. Dieser Pragmatismus ist in der Gestaltung vom ersten Tag an enthalten.
Der Einbau von Toiletten konnte nicht, wie sonst oft üblich, ums Eck und mit einem Gang, sondern musste im begrenzten Bereich des erdgeschoßigen Gastraums erfolgen. Sie stehen nun als teils polygonal verformte und damit abgeschwächte Volumen im Hintergrund über dem Abgang zum Keller – nicht Fremdkörper, sondern notwendige Einbauten, die durch die Farbgebung, ein freundliches Grau, der oberflächlichen Wahrnehmung entzogen sind. – Die Treppenabgänge, als massive Einschnitte in die Gewölbestruktur scheinbar bedenklich, werden durch die Art und Weise, wie sie ausgeführt wurden, verträglich gemacht. Der vordere, kleinere erhielt über dem Abgang eine knappe Sitzgelegenheit mit Tischchen für vier Personen, von der nicht klar ist, aus welcher Zeit sie stammt, sodass der Eingriff, obwohl neu, schwer datierbar wird. Beim hinteren, größeren Abgang wird mit zwei schlanken Rundstützen überspielt, dass hier der Gewölbeansatz weggeschnitten werden musste.Nicht die Verletzung ist das Thema, sondern deren architektonische Sublimierung.
Seltenes Wissen, rares Handwerk
Im großen Weinverkostungsraum, zugleich der festlichste, wird der Treppenaufgang durch das Weinlager – klimatisiert und hinter Glas – abgeschirmt, sodass die vordere Raumzone mit einem großen Tisch zentriert und, von siamesischen Zwillingskandelabern flankiert, aufgewertet wird. Bestätigend kommt ein hochwertiger Steinboden dazu, der, in diagonalem Schachbrettmusterverlegt, Besonderheit ausdrückt. Was niemand merken wird: Vom rechten Winkel weichen die scheinbar quadratischen Platten um wenige Grade ab, um der zum Parallelogramm verzogenen Raumform zu folgen.
Bei den Farben nützt Hermann Czech das gesamte Angebot des Doppelkegels im räumlichen Farbspektrum zwischen Schwarz und Weiß, wobei es ihm um die Wirkung geht. Besonders mag er jene Farbtöne, die recht eigentlich übersehen werden, mit denen sich Flächen in die Umgebung einbinden lassen. Es kann aber auch eine klar gesetzte Maßnahme sein, wie das glanzblaue Gewölbefeld über dem Tisch im oberen Gastraum, das den Raum scheinbar höher macht.
Dass Hermann Czech ein großer Lehrender ist, hat er oftmals bewiesen und tut dies heute an der Technischen Hochschule in Zürich. In dem schmalen Heft über das Weinhaus Punkt erläutert er Christoph Mayr Fingerle in einem Gespräch ausführlich seine architektonischen Intentionen. So viel klar formuliertes Wissen zum gestalterischen Handwerk des Architekten konnte man in den letzten Jahren kaum wo lesen.
Elegant, städtebaulich sensibel, und ein Weltrekord: die 230 Meter weite Rad- und Fußgängerbrücke über den Rhein. Ein Werk der Auslandsösterreicher Dietmar Feichtinger und Wolfgang Strobl.
Als Erste nahmen die Möwen Besitz vom neuen Bauwerk, das eine Fähre zwischen dem deutschen Weil am Rhein und dem französischen Huningue ersetzt. Während sie den Vögeln als temporärer Aufenthaltsort dient, ist die Brücke für die Menschen in den urbanen Gebieten beidseits des Stromes als verbindendes Element von alltagspraktischer und symbolischer Bedeutung. Sind es doch im Rheinknie, zwischen Groß- und Kleinbasel, wo der Strom, von Osten kommend, sich nach Norden wendet, fünf Brücken, ein Wehrübergang und vier Fähren, die den Austausch sichern, während erst weit unterhalb der „Pont Palmrain“ auch Fußgängern und Radfahrern einen Übergang anbietet.
Die neue Brücke ist trotz der Weite des Stromes von 240 Metern ein urbanes Bauwerk. Sie liegt auf deutscher Seite in der Verlängerung der „Hauptstraße“ von Weil und trifft auf französischer Seite auf die „Rue de France“, die nach 200 Metern in die zentrale „Place Abbatucci“ mündet. Dies legt ihre städtebauliche Bedeutung fest. Und selbst Bewohner von Kleinbasel freuen sich über diesen direkten Radweg ins Elsass. Von der Brücke aus genießt man stromaufwärts beste Sicht auf die manövrierenden Schiffe vor dem Basler Rheinhafen, und im Hintergrund sind die Bauten des in Transformation befindlichen Novartis-Campus zu erkennen.
Die Stadt Weil am Rhein als Vertreterin der Bauherrschaft, der „Communauté des Trois Frontières“, war daher gut beraten, als sie 2001 einen Wettbewerb ausschrieb, den die Arbeitsgemeinschaft Feichtinger Architectes, Paris und Leonhardt, Andrä und Partner, Berlin gewann. Knappe 200 Meter unterhalb des politischen Einflussbereichs der Basler Stararchitekten schlug das Siegerteam eine elegante Stahlbogenbrücke vor, die mit einer einzigen Öffnung von 230 Metern den Rhein überspannt. Die Fahrbahnplatte dient als Zugband, sodass außer den Windlasten nur senkrechte Auflagerkräfte zu bewältigen sind. Um die Sicht auf den historischen Turm am Hauptplatz von Huningue nicht zu verstellen, verläuft die Brücke an der Nordseite der beiden neu verbundenen Straßenräume - eine städtebauliche Sensibilität, die heute nicht selbstverständlich ist. Zudem weist sie ein asymmetrisches Tragwerkskonzept auf: Der nördliche Bogen ist erkennbar kräftiger und besteht aus zwei Sechseckrohren. Der südliche, ein Rundrohr, neigt sich Ersterem zu, sodass die Blickachse zwischen den benachbarten Orten offen bleibt. Die gute Nachbarschaft Frankreichs und Deutschlands sowie die städtebauliche Einbindung bilden den Symbolgehalt des nicht bloß funktionalen, sondern wohlproportionierten und eleganten Bauwerks.
Doch damit sind die gestalterischen Überlegungen, die integral zum Wesen des Tragwerks gehören, nicht abgeschlossen. Die Bogenform, zu Beginn des Entwurfs einer quadratischen Parabel folgend, was einen stärker gekrümmten Scheitel und geradere Schenkel ergeben hätte, wurde in den Viertelpunkten um 40 Zentimeter angehoben. Sie wirkt nun runder, auch weicher, und entspricht einer Polynomfunktion vierten Grades. Besonders in der Schrägsicht bleibt der Kurvenschwung stetiger, und in der Seitenansicht wirkt der Bogen ruhiger und weniger angestrengt.
Um diese Leichtigkeit auch in die Uferbereiche auszudehnen, verzichteten die Planer bewusst auf massive Brückenköpfe und lösten die anfallenden Kräfte in ein räumliches Fachwerk auf. Leichtfüßig setzen die Bogen auf den nahe dem Ufer im Wasser befindlichen Fundamentpfeilern auf. Zwei kräftige Druckstreben leiten den Horizontalschub wieder zum Ende der Fahrbahnplatte hinauf, diese verbindet die Zugkräfte über den Strom hinweg. Die verbleibenden Vertikalkomponenten werden mit zwei Zugstäben im Untergrund verankert. Optisch bilden die Druckstäbe einen Auftakt zum großen Bogen und lassen den Übergang dynamischer wirken. Damit wird die Kontinuität betont. Schwere Brückenköpfe hätten unnötigerweise militärische Erinnerungen geweckt und in die Uferwege Zäsuren gesetzt.
Gewiss ist die Gestaltung eines Fußgänger- und Radfahrerstegs, bei dem die Hauptlasten das Eigengewicht und die Windkräfte sind, einfacher als etwa eine Autobahnbrücke. Aber die 230 Meter Spannweite bedeuten in dieser Kategorie derzeit Weltrekord, und der geringe Bogenstich von 23 Metern war ingenieurtechnisch eine Herausforderung. Bis in die Details reicht die planerische Sorgfalt. So wurden die Durchdringungen der Fahrbahnrandträger mit den Bogen als anspruchsvolle, exakte Stahlgussteile hergestellt, und alle übrigen Gelenke, Stäbe und Kraftanschlüsse sind bewusst, aber nicht verspielt gestaltet.
Das sensationelle, aber eben nicht sensationalistische Bauwerk verdankt seine Qualität zwei österreichischen Fachleuten, die seit Jahren im europäischen Ausland leben und arbeiten. Der Architekt Dietmar Feichtinger hat in Graz an der Technischen Universität studiert, arbeitet seit 1989 in Paris, seit 1994 mit eigenem Büro und ist auch in Österreich aktiv, wie der Campus Krems und das Kunsthaus Weiz sowie Wettbewerbsteilnahmen und -gewinne belegen. In Paris wurde voriges Jahr die Passarelle Simone-de-Beauvoir über die Seine, auch ein Wettbewerbsgewinn, eingeweiht. Seine konstruktive Kompetenz kommt bei den von ihm entworfenen Bauwerken in unaufdringlicher Weise zum Ausdruck.
Der Bauingenieur Wolfgang Strobl stammt aus Weiz, hat ebenfalls an der Technischen Universität Graz studiert und ist seit 1994 im Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä und Partner tätig; seit 2000 als Gruppenleiter Hoch- und Ingenieurbau im Zweigbüro Berlin. Der vor wenigen Jahren verstorbene Gründer der Firma, Fritz Leonhardt, war einer der gezählten großen Bauingenieure im 20. Jahrhundert. Wolfgang Strobl konzentrierte sich früh auf die Softwareentwicklung zur statischen und dynamischen Berechnung anspruchsvoller Tragwerke. Als verantwortlicher Bauingenieur für die Brücke über den Rhein übernahm er in der Arbeitsgemeinschaft mit Dietmar Feichtinger, den er seit Studienzeiten kennt, die kaufmännische und technische Federführung.
Neben den beachtlichen gestalterischen und ingenieurtechnischen Qualitäten verweist das Bauwerk überdies auf ein Problem, das vor allem kleinere Staaten betrifft, dessen man sich aber meist kaum bewusst ist: das des Kaderexports. Zahlreiche Fachleute werden an den heimischen Universitäten ausgebildet. Oft sind es die Fähigsten und Kreativsten, denen es im Kleinstaat zu eng wird, sodass sie im nahen oder fernen Ausland nach Entfaltung suchen. Es ist aber die Ausnahme, dass solche kompetente Köpfe samt ihrer gesammelten Erfahrung zurückgeholt werden. Oft genug ist dem das Kartell der Daheimgebliebenen davor.
Muss die Erhaltung wertvoller Bausubstanz nur Sache des Staates sein? Was ein privater Verein hier leisten kann, zeigt eine kleine Erfolgsgeschichte aus der Schweiz.
Vergangenes Jahr wurde in Stäfa am Zürichsee ein Haus eingeweiht, das 1928 einige Wochen als mittelständisches Fertighaus in Bern zu sehen war und danach 70 Jahre in Aarau als Wohnhaus diente. Vom Abbruch bedroht, wurde es 2003 demontiert und wird heute, wieder hergestellt, am neuen Standort als Eltern-Kind-Zentrum genutzt. Es handelt sich um das „Saffa-Haus“, entworfen von Lux Guyer (1894 bis 1955), der ersten selbständigen Architektin der Schweiz, damals Chefarchitektin der „Schweizer Ausstellung für Frauenarbeit“, Saffa 1928.
Die Gründe, sich ein weiteres Mal mit dem Haus und seiner Fortsetzungsgeschichte zu befassen, sind mehrere: Da ist zuerst die zivilgesellschaftliche Initiative zur Rettung und Neuaufstellung; dann die bis heute prinzipiell wegweisende Holzkonstruktion aus großen, vorgefertigten Tafelelementen; weiters die in der Architekturgeschichtsschreibung bisher gering geschätzte Fortführung der vor dem Ersten Weltkrieg entstandenen Reformbewegungen und deren Verknüpfung mit Elementen der Avantgarde der 1920er-Jahre, aber ohne die fatale Neigung ihrer radikalen Vertreter, jeweils das Kind mit dem Bad auszuschütten. Eine gewichtige gesellschaftliche Strömung, die vom Weltkrieg und seinen dekultivierenden Begleiterscheinungen nicht verschüttet oder radikalisiert worden war, ist die Bewegung für Frauenrechte, die in der Schweiz das Stimmrecht einforderte und mit der „Saffa“ zu befördern hoffte. Dessen Gewährung auf Bundesebene, 1971, war mehr als spät. Lux Guyer hat in ihren Hausentwürfen einer eigenständigen Rolle der Frau in Familie und Gesellschaft wesentliche Überlegungen gewidmet und gestalterisch umgesetzt, wie Dorothee Huber in ihrem grundlegenden Beitrag im kürzlich erschienenen Buch über die „drei Leben des Saffa-Hauses“ ausführt.
Nachdem die Erstbesitzerin 1986 hochbetagt verstorben war, diente das in öffentlichen Besitz gelangte Haus sozialen Zwecken. Das gewerblich und von Verkehrsträgern bestimmte Umfeld bedrängte das isolierte Wohnhaus. Der Aarauer Baudirektor wusste um den Wert des Hauses und bemühte sich um dessen Erhaltung. 1999 erfolgte ein Abbruchbescheid, der aber immer wieder ausgesetzt wurde. Als nichts weiterging, wandte er sich an eine Nichte Lux Guyers, die Zürcher Architektin Beate Schnitter. Umgehend setzte sich diese mit drei Kolleginnen zusammen, denen Guyers Werke vertraut waren.
Dass ein geschichtsträchtiges Haus gerettet werden müsste, darüber kann man am Wohnzimmertisch leicht Reden führen; etwas anderes ist es, die Idee umzusetzen. Die vier Architektinnen fackelten nicht lange, gründeten im Jänner 2002 einen Verein, der unter der engagierten Führung von Rita Schiess nach wenigen Monaten auf über hundert Mitglieder anwuchs. Insbesondere bezweckte er „die Sicherstellung der historischen Bausubstanz, eines geeigneten Grundstücks, der Finanzierung und der Realisierung des Wiederaufbaus, des Fortbestehens sowie der Unterschutzstellung des Saffa-Hauses“. Der Verein traf die Abklärungen für ein Nutzungskonzept, über die zu erwartenden Kosten und suchte nach Interessenten für das Haus, die über ein passendes Grundstück verfügten. Neben anderen war es die Gemeinde Stäfa, die das Haus einfach haben wollte. Noch während der Sommerferien wurden die nötigen Beschlüsse der Gemeindegremien gefasst und ein Grundstück in zentraler Lage bereitgestellt. Die vorgesehene öffentliche Nutzung als Eltern-Kind-Zentrum (Tagesmütterverein, Kinderhütedienst, Krabbelgruppe, Elternberatung et cetera) überzeugte, und Stäfa erhielt den Zuspruch. Im September wurde der Vertrag unterzeichnet.
Am intensivsten beschäftigte den Verein die Finanzierung. Der Hauptteil der benötigten circa 900.000 Euro war bis Ende 2005 beisammen. Zehn Prozent stammten vom Verein selbst, fast ebenso viel von Privaten, knapp ein Fünftel von Organisationen und Stiftungen, etwas über die Hälfte brachten Gemeinden, Kanton(e) und der Bund auf, die verbleibenden sieben Prozent stammten von Unternehmen. Obwohl das Ansinnen allseits begrüßt wurde, gab es knifflige Probleme zu lösen: Versuchen Sie einmal, im wahrscheinlich föderalistischsten Land der Erde ein demontiertes, als bewegliche Sache deklariertes, im Kanton Aargau eingelagertes Holzhaus im Kanton Zürich unter Denkmalschutz zu stellen, für einen offiziellen Beitrag jedoch Bedingung. Allseits guter Wille und gradlinige Beschlussfassungen erlaubten ab Juni 2005 den Wiederaufbau.
Was sich schon beim Abbau gezeigt hatte, bewies die neuerliche Montage: Das damals pionierhafte Vorfertigungssystem der Holzbau AG Lungern aus tafelartigen Großelementen ließ sich nach den Passmarken der Erstaufstellung wieder exakt zusammenbauen.
Die Nachhaltigkeit ist nicht bloß eine materielle, sondern ebenso eine ideelle. Ausgehend von einem der Architektin aus eigener Erfahrung vertrauten, von den Aufbruchstendenzen nach 1900 aktualisierten britischen Wohnstil, setzt sich das kompakte und doch gegliederte Haus aus mehreren Raumgruppen zusammen, die sowohl in sich, als auch untereinander starke räumliche Qualitäten und Beziehungen aufweisen, die dem vielfältigen Leben einer unbekannten Bewohnerschaft zugedacht waren. Dorothee Huber zählt im ganzen Haus nicht weniger als sechs individuelle Arbeitsplätze - ohne die temporären in der Küche. Damit drückt sich im Grundriss eine gesellschaftliche Gleichwertigkeit der einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner aus, ob erwachsen, oder noch in Entwicklung. Diese Botschaft ist um vieles aktueller, als die auf Taylor und Ford zurückführbare, gleichschalterische Durchfunktionalisierung der Wohnungen, die in den 1960er-Jahren als Bauwirtschaftsfunktionalismus einen unrühmlichen Höhepunkt erlebte. Das differenzierte Raumangebot wäre ebenso für eine Patchwork-Familie geeignet, so wie es ohne architektonische Einbußen als Eltern-Kind-Zentrum nutzbar ist.
Anders als von der medialen Wahrnehmung der frühen Moderne in Schwarz-Weiß kontrastierenden Fotografien provoziert, waren und sind Lux Guyers Häuser lebendig bunt. Die originale Farbgebung und Materialwahl wurde, nach sorgfältiger Befundung durch die Farbenspezialistin Katrin Trautwein, im wieder aufgerichteten Haus zur Wirkung gebracht. Damit wird eine lang verdrängte, polychrome Architekturtradition betont und 1 : 1 nachvollziehbar. Und nach all diesen tollen Leistungen kann sich der Verein getrost auflösen.
Eine Würdigung des Pionierwerks sowie die Hintergründe seiner Entstehung und Rettung sind nachzulesen in: „Die drei Leben des Saffa-Hauses. Lux Guyers Musterhaus von 1928“, herausgegeben vom Verein proSAFFAhaus und dem Institut für Geschichte und Theorie der Architektur, gta Verlag, Zürich.
Eine frühere Würdigung im „Spectrum“ vom 7. Juni 1997 ist nachzulesen unter www.nextroom.at (Suchwort: Saffa).
Hätten Sie Lust, einmal mit anderen Augen durch eine Stadt zu gehen? Oder mit frischer Neugier durch ein Haus? Über Wege, sich dem Phänomen Architektur zu nähern.
Als kulturinteressierter Mensch möchte man vielleicht gern wissen, wie ein Zugang zur Architektur zu finden wäre, der tiefer in den Gegenstand einzudringen vermag und nicht an Oberflächlichkeiten kleben bleibt. Der über ein vordergründiges Geschmacksurteil: „gefällt - gefällt nicht“ hinausführen könnte, hin zu einem erkenntnisgestützten Zugang, der das Verstehen von Sachverhalten und Zusammenhängen fördert. Das ist mit geistiger Arbeit verbunden. Einer Arbeit allerdings, die nicht entfremdet ist und die gebaute Umwelt reichhaltiger und interessanter werden lässt, weil diese uns mehr und mehr zu sagen vermag.
Denn die Architektur, das sind die vielen Architekturen, von den frühesten Zeugnissen des Bauens bis herauf in unsere Zeit. Oft als parallele Strömungen in derselben Epoche, wie es sie als Ungleichzeitigkeiten, als regionale Eigenheiten oder schlicht zeitgleich immer gegeben hat. Dabei gilt es zu bedenken, dass manche Zeugnisse von Architekten der Propagierung der eigenen Werke dienten, dass „eingebettete“ Kritiker oft Parteimeinungen vertraten und dass spezifische Machtverhältnisse die Quellen trüben können. Erst eine von vielfältigen Verunreinigungen einigermaßen geklärte, sprich: quellenkritisch aufgearbeitete Architekturgeschichte vermag der Architektur als Ganzer zu nützen. Unterbleibt dies, setzen sich Missverständnisse und Fehlinterpretationen fort.
Beispielsweise ist es für Verfechter einer Weiterführung der Moderne unabdingbar, dass sie deren Kritiker von Adolf Behne über Josef Frank und Aldo van Eyck samt Team 10 und manche andere, bis zum Verschimmelungsmanifest von Friedrich Hundertwasser oder Rolf Kellers Buch „Bauen als Umweltzerstörung“ ernst nehmen. Denn nur was begründeter Kritik standhält, wird besser und dauerhaft gut.
Dabei soll nicht vergessen werden, dass weder Fliegerbomben noch Abbruchhämmer architektursensibel waren und sind, dass politische und wirtschaftliche Verhältnisse um vieles stärker sein können als architektonische Werte. Aber die Antwort eines Soziologieprofessors Anfang der 1970er-Jahre auf den Bildungswunsch, das Feld architektonischer Wirkungen zu ergründen, die da lautete: Architektonische Zeichen seien anderen deutlich nachgereiht, sodass eine Erhöhung des Raumes um einen Meter gegenüber dem Aufhängen eines Che-Guevara-Posters keine Chance hätte, lässt sich heute nicht mehr halten. Nicht wenige nach der Veränderung befragte junge Menschen von heute würden antworten: „Der Raum ist höher geworden; aber wer ist der Typ an der Wand?“ Dieses gewachsene Interesse an Architektur gilt es mit qualifizierten Inhalten zu bedienen und zu fördern.
Aber Wahrnehmung von Bauwerken erschöpft sich nicht in zweidimensionalen Ansichten, ob als Fotografien oder am Bildschirm, vielmehr verdichtet sie sich im bewussten wie gefühlsmäßigen Bewegen in einer realen räumlichen Struktur, die dank eines den Menschen gegebenen topologischen Gedächtnisses durch Erinnern und Wissen über das unmittelbar Sichtbare weit hinausreicht. Dabei sind Grundrisszeichnungen eine wichtige Stütze und Hilfe zum vertieften Verständnis. Zum einen liefern sie einen Überblick über die Verteilung der Funktionen und deren Beziehungen untereinander. Zum anderen geben sie jene Ordnungen wieder, die räumliche Strukturierungen, Zonierungen, Trennungen und spezielle Wirkungen erzeugen.
Grundrisszeichnungen sind Abstraktionen, aber sie geben das Konzept wieder und liefern ein Grundgerüst, in dem weitere Informationen über Materialien, Oberflächen, Licht und Beleuchtung dazugedacht und miteinander in Beziehung gebracht werden können. Darum ist es sinnvoll, wenn sich nicht nur Fachleute, sondern mit Bauen befasste Politiker sowie alle an Architektur Interessierten Grundrisse verstehen, damit sie sich nicht von platten Bildern blenden lassen. Denn auf einem Grundriss kann man sich gedanklich an jeden Punkt in einem Gebäude begeben und die räumliche Wirkung imaginieren. Ein Schaubild hingegen gibt nur einen einzigen Standpunkt vor. Das bedarf einiger Übung, und nicht jeder und jedem mag es gleich gut gelingen, ein Bauwerk vor dem inneren Auge erstehen zu lassen. Aber was geht schon ohne Üben?
Einen möglichen Einstieg - nicht bloß für die von ihr unterrichteten Studierenden - hat die Wiener Architektin und Professorin an der TU Stuttgart Franziska Ullmann verfasst: „Basics. Architektonische Grundelemente und ihre Dynamik“. Was anfänglich noch simpel scheinen mag, verdichtet sich zusehends zu einer Einführung in räumlich-architektonisches Erleben. Mit zahlreichen Bildbeispielen, gespeist von vielen Reisen, wird die umfangreiche persönliche Architekturerfahrung geordnet, verallgemeinert und nachvollziehbar gemacht. Zwar gibt es für die Architektur keine absolute oder eindeutige Lexik der Bedeutungen, weil die Elemente in ihrem Zusammenwirken und in Abhängigkeit der Bedeutungszuschreibung durch Nutzungen in ihrer Aussage variieren können. Für einen ersten, davon losgelösten, abstrakten Zugang zu räumlichen Wirkungen sind die „Basics“ jedoch äußerst hilfreich. Man spaziert hernach mit anderen Augen durch eine Stadt, bewegt sich mit frisch gewonnener Neugier in einem Gebäude.
Wenn man dann an einer der zahlreichen in und um Wien angebotenen Besichtigungen, Bauvisiten, Architouren und so weiter teilnimmt, geht man offener auf ein Bauwerk zu und vermag einer unverschleierten Erläuterung durch Fachleute besser zu folgen. Denn Vorsicht, nicht alle Architektenaussagen decken sich auch mit den architektonischen Sachverhalten, und in der Wortwahl sind sie oft kreativer als beim Projektieren. Aber was nicht konkret am oder im Bauwerk vorhanden ist, lässt sich nicht herbeireden. Darum ist es für sogenannte architektonische Laien nicht schlecht, wenn sie Pläne lesen und einer architekturbezogenen Sprache zu folgen vermögen, um sich eine eigenes „Bild“ zu machen.
[ Eine anschauliche Einführung in das räumlich-architektonische Erleben bietet Franziska Ullmanns jüngst bei Springer, Wien, erschienener Band „Basics. Architektonische Grundelemente und ihre Dynamik“ (208 S., brosch., € 39,90). ]
verknüpfte Publikationen
- Basics
Sie werden kaum aussterben, jene Architekturschreiber, die vom Büropult aus, hinter Stapeln internationaler Zeitschriften dem Klischee frönen, in den ländlich-industriell geprägten Bundesländern Niederösterreich oder Oberösterreich sei es mit akzeptabler Architektur nicht weit her. Denn, so meinen und vertreten sie offenbar, die wirkliche Architekturkultur sei nur in den großen Zentren zuhause. Sie verkennen jedoch den Strukturwandel der vergangenen zwei, drei Jahrzehnte, in denen das Bildungsprivileg der großen Städte von engagierten landstädtischen Gymnasien unterlaufen wurde, sodass in Gebieten, in denen bisher brave Baumeister den Stil vorgaben, neuerdings der Region entstammende Architekten sich wieder dort niederlassen und ihre nicht selten internationale Erfahrung zu qualifizierten Bauwerken konkretisieren.
Unter dem Vorsitz der engagierten Publizistin und Architektin Romana Ring-Szczurowsky ergriff daher das Architekturforum Oberösterreich zusammen mit dem führenden regionalen Printmedium, den „Oberösterreichischen Nachrichten“, die Initiative. Sie wollten wissen, wie die oberösterreichische Wirtschaft baut. Über einen Wettbewerb, der sich an Industrie, Gewerbe und Handel richtete und bei dem vor allem das Engagement der Bauherrschaften ausgezeichnet werden soll, kamen beachtliche 85 Einsendungen zustande. Eine Endauswahl wurde eingehend besichtigt, wovon der Schreibende profitieren und sich beeindrucken lassen durfte. Der folgende Querschnitt versucht subjektive und regionale Argumentationslinien einander anzunähern, ohne damit den Juryentscheid relativieren oder kommentieren zu wollen.
Bei der Fahrt durch Oberösterreich liegen oft genug ausgedehnte Felder und kleine Waldstücke beidseits der Landstraße. Doch unvermittelt taucht über einem noch stehenden Maisfeld ein lang gestrecktes Gebäude auf, dessen riesige Ausmaße sich nur erahnen lassen. Die Produktions- und Lagerhalle der Firma Fronius bei Sattledt, entworfen von den Architekten Benesch und Stögmüller, ist noch im Bau. Sie liegt über den Einstellhallen für die Mitarbeiterautos. Damit entfallen die Land fressenden Parkierungsflächen, wie man sie sonst von Anlagen dieser Größe kennt. Die Fassaden sind plastisch gegliedert, was mithilft, trotz der riesigen Dimensionen den Maßstab zu wahren.
In Schwanenstadt hat die Holzbaufirma Obermayr von „F2 Architekten“ eine Fertigungshalle planen lassen. Die beiden „F“ stehen für Markus Fischer und Christian Frömmel, die ihren Bürositz in Schwanenstadt haben. Die Dachkonstruktion der Halle besteht aus langen, tafelartig gegeneinander verfalteten Sandwichelementen aus Holzwerkstoffen. Aus der Differenz ergibt sich die Höhe der Fachwerkträger, die mit schlanken Diagonalen aus Stahl (siehe Foto)
sich vor den aufgespannten Oberlichtern hinziehen. Raumkonzept, Tragwerk und Lichtführung bilden gemeinsam ein integrales Ganzes. Gleichsam beiläufig kommt dazu, dass die Anlage als Null-Energie-Gebäude funktioniert.
Nahe der Autobahn bei Schörfling kann man einen langen, quaderförmigen Baukörper ausmachen, dessen rational abstrahiertes Tragwerk hinter einem extrem zart wirkenden Vorhang einer großflächigen Glasfassade zu erkennen ist. Die wasserhelle Membran ist Programm, denn die international tätige Firma produziert Glasfassaden. Heidl Architekten aus Leonding haben den Firmenanspruch bildwirksam ungesetzt.
Aber nicht nur große Anlagen, die auf der grünen Wiese geplant werden konnten, zeichnen sich durch ihre Architekturqualität aus. Mittelgroße Bauaufgaben, als Zubauten oder im städtebaulichen Kontext für entsprechende Firmen errichtet, fallen genauso positiv auf. Da ist das Bürohaus Schrangl, Preslmayr, Schauhofer in Linz der Architekten Schneider & Lengauer. Anthrazit eingefärbter Sichtbeton mit geometrisch exakten Kanten prägt das äußere Bild, das sich im Inneren fortsetzt. Doch gelingt es, der Härte des Materials dank der Einfärbung einen überraschend sanften Charakter abzugewinnen, der zu durchaus angenehmen Einzel- und Großbüros führt.
Ebenfalls mit durchgefärbtem Beton arbeitete Architekt Andreas Heidl für ein bei Gunskirchen errichtetes Bauwerk, in dem heiratswillige Paare sich ihre Gewandung aussuchen und bei der großen Auswahl, die von Erika Baudisch bereitgehalten wird, wohl auch finden können. Mächtige vorgefertigte Elemente aus terracotta-rosa eingefärbtem Beton sind lapidar auf- und ineinander gefügt. Nach außen ergibt dies, wie auf dem Foto zu erkennen ist, ein unverkennbares Bild. Im Inneren kontrastiert die fast samtig wirkende Oberfläche zu den feinen und duftigen Stoffen. Durch große Glasflächen im Dach einfallendes Licht erzeugt zusammen mit dem warmen Farbton eine mediterrane Atmosphäre, eine Erinnerung an gern gewählte Ziele für die Reise nach der Trauung.
Ein Haus mit jahrhundertealter Tradition, das Stift Schlierbach, plante, den Verkaufsbereich zu adaptieren. Die Welser Architekten Maximilian Luger und Franz Maul schlugen vor, nach einem betrieblichen Gesamtkonzept ein „Genusszentrum“ zu errichten, in dem die Produkte des Stifts besichtigt, genossen und erworben werden können. Auf den mehrgeschoßigen Sockel eines alten, an die Hügelkante gelehnten Ökonomiegebäudes setzten sie ein leichtes und transparentes, neues Dachgeschoß. Zu den barocken Gebäuden im ersten Stiftshof tritt es mit einer hohen Vorhalle in Erscheinung, die zu den beiden anderen eine städtebauliche Konstellation eingeht (siehe Foto). Am anderen Ende bietet eine gedeckte Terrasse hoch über den Häusern der Ansiedlung einen überwältigenden Ausblick über die nach den Voralpen flach auslaufende Landschaft.
Doch auch räumlich kleine Aufgaben vermögen architektonisch zu strahlen, wie das Verkaufslokal des Juweliers Mayrhofer am Linzer Hauptplatz beweist. Die historischen Gewölbe erhielten eine komplett neue, zeitgenössische Auskleidung mit einer völlig anderen aber durchaus starken Raumwirkung.
Weniger heftig verfuhren in Wels die Architekten Benesch & Stögmüller für das Friseurgeschäft „Hairline“. Einfühlsam wurden verschiedene Raumzonen konzipiert, und einer seriellen Anordnung der Frisierplätze wurde mit geschickten gestalterischen Maßnahmen entgegengewirkt.
Ein Feuerwerk aus Glas und Metall zündete das junge Büro „two in a box“ für die Filiale der Sparda Bank am Linzer Lenauplatz. Andreas Fiereder und Christian Stummer gelang es, wie das Foto zeigt, in dem hohen Raum unter der bloß geweißten rohen Betondecke mit frei hineingestellten Elementen diesen sowohl zu strukturieren als auch durchfließen zu lassen. Bankgeschäfte sind hier nicht geheimnisvoll, sondern sprechen breite Kreise an. Und doch bleibt das, was privat sein soll, privat. Insgesamt sammelt sich nach der längeren Fahrt durch das Land die Erkenntnis, dass qualitätsvolle Architektur in Oberösterreich nicht nur von einem Zentrum ausgeht, dass sie zwar handfest, aber selten verspielt ist und daher über eine vernünftige Halbwertszeit verfügt.
Eine hierzulande noch kaum genutzte Möglichkeit, mehr Raum für ein Museum zu gewinnen: Die Mäzene Jeanne und Donald Kahn sponsern den Ausbau der Wiener Albertina.
Das Mitte 18. Jahrhundert als Palais Tarouca erbaute, zur Empirezeit erweiterte und von Josef Kornhäusel 1822 bis 1824 mit mehreren prächtigen Innenräumen ausgestattete Bauwerk hoch auf der Augustinerbastei enthält eine der drei größten grafischen Sammlungen der Erde: die Albertina. Nachdem vor wenigen Monaten die Musiksammlung der Nationalbibliothek in das erneuerte Palais Mollard an der Herrengasse neun übersiedelte, wurden im vierten Obergeschoß Räume frei. Die Chance, die Ausstellungsflächen im dritten Obergeschoß (1000 Quadratmeter, damals mitgesponsert von der „Propter Homines Stiftung“, Vaduz, und nach ihr benannt) im Geschoß darüber um 700 Quadratmeter zu erweitern, wollte sich der Direktor der Albertina, Klaus Albrecht Schröder, nicht entgehen lassen. Denn sein Konzept, neben Grafikwerken aus der eigenen Sammlung auch thematisch verwandte Ölbilder internationaler Leihgeber zu zeigen und damit ein breiteres Publikum anzusprechen, erforderte mehr Raum.
Da ohne öffentliche Mittel umgebaut werden sollte, galt es, einen Sponsor zu finden. Der Amerikaner Donald Kahn, der in Österreich beträchtliche Summen für die Salzburger Festspiele bereitstellte und in den USA sowie in Großbritannien mehrere Museen unterstützt, ließ sich über das Entwicklungspotenzial informieren und ermöglichte den Umbau mit einer siebenstelligen Summe. Dieses in den USA verbreitete Mäzenatentum ist in Europa noch wenig üblich. Voraussetzung sind allerdings ein guter Name und attraktive Perspektiven der unterstützten Institution. Kleinere und bloß regional bedeutsame Häuser haben meist das Nachsehen. Doch wäre es einfältig, der Albertina ihren internationalen Rang vorzuwerfen, lassen sich doch in ihrem Strahlungsfeld auch die Marktchancen anderer verbessern.
Zum Dank an die Sponsoren erhalten die neuen Räumlichkeiten deren Namen: „Jeanne & Donald Kahn Galleries“. Die neuen Ausstellungsräume können separat oder gemeinsam mit der Propter Homines Ausstellungshalle bespielt werden. Eröffnet werden sie mit einer breiten Darstellung des Spätwerks von Pablo Picasso.
Abgesehen von zeitgemäßer Technik für ein stabiles Klima, ultraviolettfreier Beleuchtung und Sicherheitseinrichtungen nach neuesten Standards, ohne die heute weder die Kunstwerke aus der Sammlung noch hochwertige Leihgaben gezeigt werden könnten, sind die Konfiguration und die innenräumliche Gestaltung der Ausstellungssäle interessant. Zuerst galt es allerdings, einige statisch wenig wirksame, aber die Raumhöhe einschränkende Verstärkungen des alten Holzdachstuhls konstruktiv zu ersetzen sowie zur Erhöhung der Erdbebensicherheit eine geschoßhohe Stahlkonstruktion einzuziehen, die als Raumtrennung mit mittigem Durchgang statisch wie eine Scheibe wirkt und auch einen Teil der Dachlasten abfängt.
Die von der Sphinxstiege her - oder mit dem zentralen Aufzug - zugänglichen Ausstellungssäle sind bezüglich ihrer Oberflächen gleich gestaltet wie jene der Propter Homines Ausstellungshalle darunter: geöltes Eichenparkett, glatte Wände, deren Farbe der Ausstellungsdramaturgie entsprechend und sogar Bezug nehmend auf einzelne Bilder bestimmt und jeweils neu aufgebracht wird. Die Decke ist hell, an den auf die Wände gerichteten Leuchtbändern fehlen auf den Baustellenfotografien noch die Abdeckungen. Was man aber darauf gut erkennen kann, ist das Konzept des selber gestaltenden Direktors, in den mehrheitlich schmallangen Räumen durch „points de vue“, sowohl im Raum selbst als auch beim Übergang zum nächsten Saal, die Möglichkeit zur Platzierung starker Bilder zu schaffen, die als Blickfang dienen, thematisch durch die Ausstellung leiten und die Besuchenden in den nächsten Raum ziehen. Daher wurden gerade Raumfluchten vermieden oder beispielsweise in den Raum hineingreifende Flügelwände eingebaut, die ihn zonieren, aber den Raumfluss nicht hemmen.
Die als Glanzlichter der Ausstellungsdramaturgie eingesetzten Bilder lassen sich auf diese Weise noch besser zur Geltung bringen. Wie man diese Möglichkeiten nützt, ob ein- oder mehrdeutig, ist einer Frage des jeweiligen Ausstellungskonzepts. Die Räume als solche bieten vor allem verschiedene Kategorien von Hintergründen.
Da wegen der konservatorisch empfindlichen Grafiken alle fünf Säle ausschließlich mit Kunstlicht beleuchtet sind, obwohl sich hinter manchen Wänden Fenster befinden, gibt es keine Ausblicke in die Stadt. Zur Kompensation bietet sich in einem Nebenbereich nahe dem Aufzug eine Pausenzone an mit Fensterblick in den glasüberdeckten Albertinahof.
An der Nordost- und der Südostseite des vierten Geschoßes entstehen die neuen Büros der Kustoden. Damit wird im neuen Studiengebäude hinter der Augustinerbastei Raum frei für den dringend benötigten externen Studiensaal. Wir verlassen daher die gleißende Oberfläche der Albertina, die ihrem Ruf, der internationalen Bedeutung gemäß, öffentlich gerecht werden muss, und begeben uns in die tiefsten Tiefen der Augustinerbastei, vor das weltweit erste vollautomatische Hochregallager für grafische Kunstwerke. Hier ruht seit Anfang Jänner dieses Jahres das kulturelle Kapital des Hauses: die Sammlung mit zirka 1,5 Millionen grafischen Kunstwerken. Vollklimatisiert, staubfrei, nicht zugänglich für Menschen, es sei denn zu Revisionszwecken der Anlage, ausgerüstet mit einer Intergen-Löschgasanlage. Volldigitalisiert kann jeder Kupferstich, jede Zeichnung, die sich jeweils mit anderen in Schachteln aus säurefreiem Karton befinden, in maximal 58 Sekunden in den Kommissionierungsraum geholt werden. Bestellungen von Forschenden werden vorbereitet, aber eine Nachbestellung aus dem Studiensaal ist innerhalb von Minuten erledigt. Mit fortlaufender Digitalisierung können immer mehr Werke an hochwertigen Bildschirmen betrachtet werden, sodass sie nicht in jedem Fall behoben werden müssen. Damit ist für die interne Arbeit und die internationale und universitäre Forschung eine neue Ära angebrochen, die wegweisend ist und auch auf diesem Gebiet einen nachhaltigen Schub auslösen wird. Bloß von außen ist davon nichts zu erkennen.
Es gibt sie noch, die Meister der Architektur und des Lehrens! Was sie ausmacht, was man von ihnen lernen kann. Eine Würdigung Kazuo Shinoharas und Ernst Hiesmayrs, die in diesem Sommer gestorben sind.
Innerhalb weniger Wochen sind diesen Sommer zwei Meister der Architektur und des Lehrens ver storben: Kazuo Shinohara und Ernst Hiesmayr. Nach der Mathematik fand Kazuo Shinohara, Jahrgang 1925, zur Architektur, in die ihn Meister Kyoshi Seike, am Tokyo Institute of Technology, einführte. Ab 1953 lehrte er selber an dieser Hochschule. Vom traditionalen japanischen Hausbau herkommend, entwickelte er einen „eigenen Stil“ anhand mehrerer Einfamilienhäuser, wobei er Abstraktion und Reduktion vertiefte. Ernst Beneder, der 1984 bei ihm in Tokyo studierte, zeigt in seinem ausgezeichneten Aufsatz im „Umbau“ (12, 1990) auf, wie über Kontakte des führenden japanischen Architekturkritikers Koji Taki zu Paris eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Theorien Roland Barthes' zustande kam. Dessen „Le degré zéro de l'écriture“ stieß nach 1970 in Japan auf großes Interesse, während Barthes seine Beobachtungen „Im Reich der Zeichen“ bestätigt sah.
Für einen Schriftsteller baute Shinohara 1974 das Tanikawahaus, dessen Äußeres einer simplen Scheune gleicht - allerdings mit geometrisch reinem 45-Grad-Satteldach. Im Sinne einer Nullpunkt-Berührung läuft im Hauptraum der leicht geneigte Hang unverändert als Humusboden durch. Er wollte nackten Raum bereitstellen, ohne Symbolik oder Bedeutung, hält er in seinem Vortrag „In Vorbereitung auf den vierten Raum“ fest („Prolegomena“, 53, 1986). Eine Stütze sollte eine Stütze sein, eine Strebe eine Strebe. Als er sah, dass dieser Raum bei den Betrachtenden dennoch Bedeutungen erzeugte, vertiefte er sei- ne Überlegungen zum Konzept der „im Nullpunkt angehaltenen Maschine“ und versuchte, dies auch in größeren Bauten umzusetzen.
Die Beziehung zu Wien beginnt 1980 mit einer Einladung an das Institut für Wohnbau der Technischen Universität, als Juror für den Prolegomena-Preis. 1986 gelingt es, Shinohara als Gastprofessor nach Wien zu holen. 40 Studierende nützen, anfangs eher zögerlich, diese einmalige Chance. 1997 organisiert das Architekturnetzwerk ORTE in der Steiner Minoritenkirche eine von Ernst Beneder gestaltete, den hohen Raum sensationell aktivierende Ausstellung. Und Shinohara kommt nach Krems, zur Eröffnung und zum Symposion „Transit.Orte.Metropolis“. Schüler aus Barcelona, Paris, Amsterdam, Berlin und Zürich reisen an, um den Kontakt mit ihm in der Diskussion zu erneuern. Und der Meister stellt Fragen, will vor allem zuhören, fragt die jungen Architekten nach ihren Überlegungen zur Zukunft der Architektur.
Im Jahr darauf vertieft er die inhaltliche Auseinandersetzung, ruft seine Schüler auf, schriftlich über Stand und Entwicklung von Architektur und Urbanismus in den Städten ihres Wirkens zu berichten. Und Shinohara reflektiert und kommentiert. Aus diesem weltweiten Diskurs entsteht ein dichtes, in Japan veröffentlichtes Buch, das belegt: Die Shinohara-Schule lebt. Ende Juni dieses Jahres starb Kazuo Shinohara. Er war aktiver Vertreter des in der japanischen Kultur bis heute verankerten und von seinen Schülern geschätzten Meistertypus. Trotz vorhandener Fesseln dieser Tradition ist ein Meister frei zu weiterer Entwicklung, entsprechend dem Kernsatz in dem japanischen Film „Der Tod des Teemeisters“: „Der Meister darf die Regeln ändern.“ - Was um 1600 noch den Tod durch Sepuku bedeutet, doch darüber ist das moderne Japan längst hinweg. In Europa hat sich ein traditionales Meisterprinzip fast gänzlich verloren. Nur mehr sporadisch finden sich Persönlichkeiten, die, meist Kraft eigenen Ringens, spontan zu jener Charakterbildung finden, in der wir Meisterschaft zu erkennen und anzuerkennen vermögen. Ernst Hiesmayr, von dem wir vergangene Woche Abschied nehmen mussten, war einer dieser raren, unmittelbar wirkenden Menschen. Selbst wenn er an einer „Massenuniversität“ lehrte, hat er eine „Schule“ begründet, deren Vitalität sich in einer wachsenden Zahl ausgezeichneter Bauten manifestiert, denn seine Theorie konstituierte sich als gelebte Praxis.
In Hiesmayrs eigenen Bauwerken findet sich ein vergleichbares Streben nach Reduktion und Klarheit wie bei Shinohara. Da sind seine „kleinen Häuser“, deren Entwürfe auf eigener Anschauung traditionaler Bautypen basieren - was seine vielen kraftvollen Skizzen belegen. In der Durcharbeitung führt er sie dann zu ungekünstelter Modernität und selbstverständlicher Einfachheit.
Mit der Heilig-Kreuz-Kirche im Langholzfeld in Pasching bei Linz, leistete Hiesmayr in den 1960er-Jahren einen grundsätzlichen Beitrag zum österreichischen Kirchenbau nach 1945. Das Urprinzip des Vierstützenhauses, der laterale Zugang durch die megalithartige Fügung der den Raum umschließenden Mauerblöcke und die als Weg und Ort integrierten Arbeiten des Bildhausers Karl Prantl verdichten sich zu einem Gesamtwerk, das der berühmten Nachbarin im Keferfeld würdig zur Seite steht.
Das Clima-Villen-Hotel in Nussdorf, eine der sensibelsten landschafts- und topografiefühligen Anlagen ihrer Zeit, ist heute zur Unkenntlichkeit verändert. Hier versagte die denkmalpflegerische Praxis, weil ein öffentliches Interesse in der Erkenntnis dieser einmaligen Qualität noch nicht ausreichend entwickelt war. Immerhin steht das Juridikum nahe der Wiener Börse auf seinen vier kräftigen Pfeilern unverändert im Stadtgefüge. Auch hier fließt der - in diesem Fall urbane - Boden, unmerklich abfallend, im Erdgeschoß des Gebäudes durch, ein anderer Kontext und doch der gleiche, die üblichen Regeln überschreitende Gedanke wie beim Tanikawahaus von Shinohara.
Die beiden Meister sind sich damals in Krems begegnet. Die Lingua franca unserer Zeit war ihrer Generation noch nicht so geläufig, der sprachliche Austausch begrenzt, aber die Hand konnten sie sich reichen, in gegenseitiger Anerkennung ihrer Leistungen. Was können wir von diesen Persönlichkeiten lernen? Sie waren wahrhaftig. Sie zählten nicht zu jenen „Meister“-Darstellern, die der Figur, die sie zu spielen vorgeben, ein mystifizierendes Mäntelchen umhängen, um Distanz zu erzeugen und „absolute Kompetenz“ vorzuspiegeln. Sie waren einzig der Sache der Architektur verpflichtet, weder politischer Macht noch der des Geldes, und kannten daher keine Berührungsängste, wussten aber, wo nötig, Distanz zu wahren. Gegenüber Gegenwart und Zukunft blieben sie stets offen, zugleich wissend, dass es absolute Sicherheiten nicht gibt, dass das Einsehen von Fehlern nicht Schwäche, sondern Stärke bedeutet und dass Unsicherheit und Zweifel auf dem Weg zur Vertiefung von Verstehen und Erfassen dazugehören. Sie stellten Fragen und suchten gemeinsam mit ihren Schülern nach Antworten. Wer kommen wollte, durfte kommen, wer da war, wurde akzeptiert, und wer eines Tages gehen wollte, ja zur persönlichen Entwicklung einfach musste, gehörte dennoch weiterhin zum großen Kreis. In einer Zeit, in der virtuell produzierte Scheincharaktere überhand nehmen, dürfen sich alle glücklich schätzen, die mit diesen starken Persönlichkeiten zusammenarbeiten durften.
Architektur, die sich selbst nicht wichtiger nimmt als nötig. Keine Sensation, dafür Qualität bis ins kleinste Detail. Die zweite Bauetappe des Bregenzer Festspielhauses ist abgeschlossen.
Mit dem Abschluss der gedrängten, zehn Monate dauernden Bauzeit wurde für den Festspiel hauskomplex ein Konzept vollendet, das die Bregenzer Architekten Helmut Dietrich und Much Untertrifaller 1992 für ihr siegreiches Wettbewerbsprojekt entwickelt hatten. Eine erste Bauetappe, die mit dem spektakulären, hoch aufgestelzten Trägerbauwerk dringliche betriebliche Probleme löste und das Raumangebot mit einem großen, unspezifisch gehaltenen Saal erweiterte, dessen Name („Werkstattbühne“) seine Bedeutung untertreibt, wurde 1997 abgeschlossen. Sie ließ den Hauptbau, das von Wilhelm Braun 1976 bis 1979 errichtete Festspielhaus, noch weitgehend unangetastet. Dieser sparsam errichtete Bau aus der Zeit vor den internationalen Erfolgen Vorarlberger Architekturschaffens basierte auf dem Projekt eines noch in den 1950er-Jahren gewonnenen Wettbewerbs und war schon bald zu eng und auch in anderer Hinsicht überfordert, auch wenn der Große Saal akustisch nicht wirklich schlecht war. Teile des Rohbaus sollten jedenfalls erhalten werden, was hinsichtlich der Raumhöhen einige knifflige architektonische Probleme stellte.
Schwerpunkt der Aufgabe war daher nicht, einen großen Wurf zu inszenieren, sondern zahlreiche große und kleine Verbesserungen zu einem neuen Gesamtkonzept zu integrieren, was bei der Komplexität der Bauaufgabe und der kurzen Ausführungszeit jede Anerkennung einfordert, die den Projektleitern und langjährigen Mitarbeitern des Büros Dietrich | Untertrifaller, Susanne Gaudl und Heiner Walker, ebenso gebührt.
Kernstück war die Erneuerung des großen Saals mit dem Einbau eines Ranges zur Anhebung der Sitzplatzanzahl. Für die akustische Optimierung zeichnete der erfahrene Spezialist Karlheinz Müller aus München verantwortlich. Dabei galt es zu berücksichtigen, dass sowohl Opern als auch Sprechtheater und sogar Kongressveranstaltungen möglich sein müssen. Ein Parkettboden statt Teppich sowie die Vergrößerung des Hallraumes nach oben durch den Einbau eines zwar blick-, aber nicht schalldichten Metallgewebes an der Decke sind die sichtbaren Maßnahmen. Erneuert wurde aber auch die gesamte Bühnentechnik, und unter den Sitzplätzen wurden je einzelne Zuluftauslässe angeordnet. Die neuen, gepolsterten Sitze sind bequem und bieten auf allen Plätzen gute Sicht. Und in der Akustik gilt: Man hört, was man sieht. Vom Rang aus ist der übrige Zuschauerbereich nahezu weggeblendet, sodass der Bühnenausschnitt optisch näher rückt. Farblich dominiert das leuchtende Rot der Sitzpolster, das mit dem warmen Dunkelbraun der Robinie für Parkett und Seitenwände gut harmoniert. Die Furniere für die Wandpaneele stammen von verschiedenen Stämmen, sodass sich ein absichtsvoll lebendiges Bild ergibt.
Im ersten Obergeschoß, an der Rückseite des Saales verbinden sich die Teilbereiche des Foyers, deren Achsen sich in einem flachen X kreuzen. Vom Eingang her führt eine breite Treppe hinauf, im Luftraum darüber entsteht eine starke, drei Geschoße hohe Innenraumfigur, deren Kraft von einer Galerie im zweiten Obergeschoß aus gut nachvollziehbar ist. Signifikant ist das Prisma, das den neuen Haupteingang an der Ostseite zum Platz markiert und beschirmt. Es enthält den „Propter Homines“-Saal, Ort vielfältiger künftiger Veranstaltungen. Darauf antwortet im Westen das aus der ersten Bauetappe stammende Seefoyer, mit breiter Fensterwand und Ausblick auf die Wasserfläche. In der Gesamtkonzeption bildet dieser räumliche Diagonalbezug eine Antwort auf das aufgestelzte Trägerbauwerk. Gemeinsam wirken sie ordnend in der komplexen Konstellation von Seebühne, Bühnenturm, Werkstattbühne, Foyers und Eingangshalle.
Das vielgliedrige Foyer dient allen Veranstaltungsstätten. Da die Raumhöhe, im zentralen Bereich, vom Rohbaubestand vorgegeben, eher knapp ist, sind Boden, Decke und die Wand zur Seetribüne hell, nahezu weiß gehalten. Räumliche Spannung erzeugen die dunkle, polygonale Rückwand des Saals und die flache Rundung gegenüber, hinter der sich die Seetribüne befindet. An solcherart schwierigen Raumkonfigurationen erweist sich die architektonische Sensibilität der Entwerfer, ging es doch nicht um ein Kaschieren, sondern um ein intelligentes Neuinterpretieren bestehender Rohbauteile.
Nach Möglichkeit wurden Bezüge zum See geschaffen, um die attraktive Uferlage, wie etwa beim Seefoyer, einzubeziehen. Neu wurde zwei Geschoße über dem Foyer die Festspiellounge angeordnet, ein VIP-Bereich mit guter Sicht auf die Seebühne, dessen Fensterfronten sich unter die Decke hochziehen lassen, ohne dass Vertikalsprossen stehen bleiben. Von hier bietet sich nicht nur eine gute Übersicht auf Bühnenbild und Spielgeschehen, sondern auch auf den See. Darüber befindet sich die Regie für die Seebühne. Gemeinsam lassen die beiden zusätzlichen, Fassade bildenden Geschoße die Ansicht zum See höher werden, denn auch nach dieser Seite wollten die Architekten die Wirkung des Gebäudes verstärken.
Nicht geringe Probleme boten die Ostseite zum neu geschaffenen Platz und die Südseite, Letztere als Ankunftsseite, vom zeichenhaften Kopf des Trägerbauwerks überragt. Das mit sechseckigen Eternitplatten verkleidete, mit vielen stumpfen Winkeln kleinmaßstäblich aufgelöste Volumen des Wilhelm-Bauer-Baus vermochte mit der neuen Größenordnung nicht mitzuhalten. Daher wurde mit Erweiterungen nach beiden Richtungen Raum für Künstlergarderoben und Vorbereitungsräume hinter der Bühne geschaffen. Nach außen galt es jedoch, die Volumen zu ordnen und in proportional vertretbare Verhältnisse zu bringen. Der dreigeschoßige Diensttrakt in hellem Grau bildet nun einen kräftigen Sockel für den markanter gewordenen Bühnenturm, während die breit gelagerte, zwecks Wärmeschutz dunkel verglaste Eingangshalle eine klare Front zum neuen Platz bildet. Bei Dämmerung wird sie einladend von innen heraus leuchten. Die offene Untersicht der zur Rechten anschließenden Seebühne sorgt für zusätzliche Dynamik. So gelingt es, trotz „Umbaus“ ein integrales Gesamtbauwerk zu schaffen, das, an einem weiträumigen, von Autos befreiten Platz liegend, bereits tagsüber dem Aufenthalt dient. Es wurde ein urbaner Ort geschaffen, an dem die Skulptur von Gottfried Bechtold einen starken künstlerischen Akzent setzt. Und an der Kante der Tribüne vorbei fällt der Blick wieder auf den See.
Dietrich und Untertrifaller geht es bei ihren Bauwerken nicht um Sensationen. Sie suchen nach Angemessenheit, dem Verbessern des Bestehenden auch im eigenen Werk. Sich selber in den Bauten nicht übertrieben wichtig zu nehmen, das zeigen auch die auf den Kontext bezogene neue Halle F im Wiener Stadthallenkomplex oder die künftige Hochschulsportanlage der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich auf dem Campus Höggerberg, deren Bau diesen Herbst beginnt. Zugleich wird das räumlich kompositorische Licht nicht unter den Scheffel gestellt und der Qualitätsanspruch bis in die Details gewahrt. Architektur aus Vorarlberg eben.
Zum Tod des Architekturpublizisten Walter Zschokke
Er hat die Architekturpublizistik Österreichs in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt. Seit 1988 schrieb der gebürtige Schweizer, Jahrgang 1948, Hunderte einschlägige Essays im „Spectrum“ – präzise, leidenschaftliche Reflexionen am Puls der regionalen und internationalen Entwicklung. Zschokkes Engagement für gestalterische Qualität in allen Maßstäben produzierte sich nie in lauter Polemik oder in brillant gedrechselten, ästhetischen Urteilen. Unbeirrt von Zeitmoden, kultivierte er die sachbezogene, vielschichtig ausgelotete Beschreibung des Faktischen als Grundlage jeder Diagnose, jeder kritischen Äußerung, jeder negativen oder positiven Wertung. Dazu befähigten ihn ein exzellentes technisch-konstruktives Wissen und Gespür, die breite Erfahrung auch als praktizierender Architekt, die kulturwissenschaftliche Schulung an der besten technischen Hochschule Europas und nicht zuletzt sein handwerkliches Know-how, speziell im Umgang mit Holz.
Aufgewachsen im Kanton Aargau, kam Zschokke nach dem Studium an der ETH Zürich, nach acht Jahren Assistenz bei Adolf Max Vogt und mit einem von André Corboz und Jacques Gubler approbierten technischen Doktorat 1985 nach Wien; hier führte er ab 1989 mit Walter Hans Michl ein Atelier, war Mitautor eines Wohn- und Bürohauses in Wien-Neubau, des Kirchenzentrums im Stadtteil Wien-Leberberg und großer städtebaulicher Wettbewerbe; 1992 gestaltete er mit Margherita Spiluttini die Fotoschau „Neue Häuser“, welche die damals junge Szene Österreichs auf vielen Stationen bis nach New York und Mexiko präsentierte; anlässlich des EU-Präsidentschaft Österreichs 1998 war er Mitautor und -gestalter der multimedialen Wanderausstellung „Architekturszene Österreich“.
Neben der Arbeit für das „Spectrum“ redigierte Zschokke etliche Architektenmonografien, war Mitbegründer von „Orte – Architekturnetzwerk Niederösterreich“, gefragter Juror und Gutachter, Vortragender. All dies wurde offiziell mit Preisen für Architektur und Publizistik von den Ländern Wien und Niederösterreich gewürdigt; zuletzt wirkte er als Juror/Mediator beim Um- und Zubau der Wiener Arbeiterkammer.
Sein bestes Buch ist die in der Schweiz verlegte Dokumentation über die hochalpine „Sustenpassstraße“, ein Standardwerk internationalen Formats an der Schnittstelle von Verkehrs- und Landschaftsplanung, von Ingenieurwesen und Architektur, von Wissenschaft und Ästhetik. Sein letzter Auftritt in der Öffentlichkeit war in Wien die Vorstellung des mit Walter Bohatsch betreuten nachgelassenen Buches „Geschautes“ von Ernst Hiesmayr.
Walter Zschokke konnte wie kein anderer konstruktive Stärken und Schwächen von Tragstrukturen auf Anhieb analysieren oder gebaute Raumereignisse in nachvollziehbare Beschreibungen gießen, vermochte aber auch aus der Betrachtung einer windschiefen Vorgartenmauer oder einer hölzernen Trinkschale ein ganzes Panorama alltagskultureller Kausalitäten und Schönheiten zu erzählen. Am 5. Februar war sein jahrelanger Kampf gegen den Krebs zu Ende, er starb im AKH, umsorgt von seiner Frau und den beiden erwachsenen Kindern. Er fehlt uns.

2008
Die Architektur von Dietrich|Untertrifaller hat eine starke Beziehung zum Ort und seinem Umfeld. Sie ist individuell aus der Situation und dem Programm entwickelt. Dies garantiert differenzierte Lösungen, Individualität und Unverwechselbarkeit. Bestehendes und Neues ergänzen einander und führen zu einem
Hrsg: Walter Zschokke
Verlag: SpringerWienNewYork

2007
Seit Jahrzehnten gleichen sich die Bürogebäude: Rasterfassade mit viel Glas, rechteckige Grundrisse. Gegen diese Klischees setzt der Neubau für die niederösterreichische Wirtschaftskammer, des Architekturbüros Rüdiger Lainer + Partner, einen überzeugenden Kontrapunkt. Das mächtige Bauwerk ist als Großform
Autor: Walter Zschokke
Verlag: SpringerWienNewYork

2006
Sowohl die Bedeutung des Holzes als Roh-, Bau- und Werkstoff als auch die Vielfältigkeit und Nutzungsmöglichkeiten der verschiedenen Holzarten werden oftmals unterschätzt. Denn jede Holzart besitzt ihre spezifischen Eigenschaften, die sich je nach Anwendungsbereich vorteilhaft einsetzen lassen. Zugleich
Hrsg: proHolz Austria
Autor: Walter Zschokke, Josef Fellner, Alfred Teischinger
Verlag: proHolz Austria

2006
Architektur hat in Niederösterreich, dem großen Bundesland rund um Wien, im Zuge der Hauptstadtplanung in St. Pölten erhöhte Aufmerksamkeit gewonnen. Seither sind im ganzen Land Bauwerke entstanden, deren Qualität Betrachtung und Auseinandersetzung lohnen. Ältere und jüngere Architekten wie Ernst Beneder,
Hrsg: Walter Zschokke, Marcus Nitschke
Verlag: SpringerWienNewYork

2003
Die präzise und materialreiche Darstellung einer wichtigen Epoche - mit überraschenden Einsichten und Anregungen für das heutige Architekturschaffen.
Hrsg: Walter Zschokke, Michael Hanak
Verlag: Birkhäuser Verlag
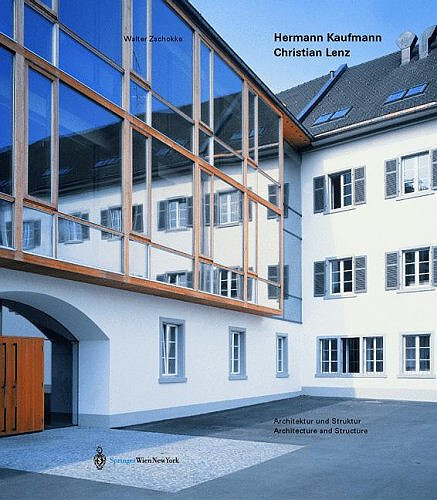
2002
In der Vorarlberger Architekturlandschaft verfolgen Hermann Kaufmann und Christian Lenz mit eigenständig und gemeinsam bearbeiteten Bauwerken eine Linie, die auf sorgfältiger Konstruktion beruht und sich an klare Geometrien und exakte Proportionen hält. Dem Baumaterial Holz und industriell erzeugten
Autor: Walter Zschokke
Verlag: SpringerWienNewYork
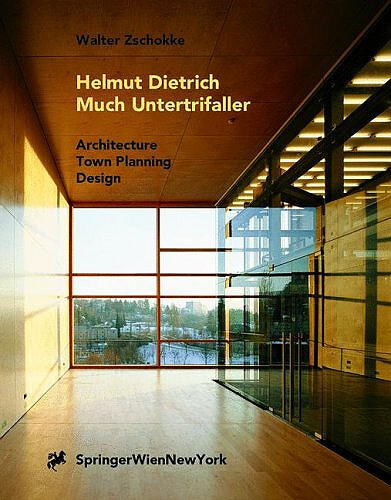
2001
Im scheinbar homogenen Architekturschaffen Vorarlbergs, das im vergangenen Jahrzehnt international bekannt wurde, treten die Bauwerke von Helmut Dietrich und Much Untertrifaller aus verschiedenen Gründen hervor: sie sind feinfühlig architektonisch und großstädtisch, sie bevorzugen keines der primären
Autor: Walter Zschokke
Verlag: SpringerWienNewYork

1999
Die erste Monographie über den österreichischen Architekten Rüdiger Lainer, der in seinen Bauten systemische Ökonomie und individuelle Lebendigkeit in Einklang bringt.
Hrsg: Walter Zschokke
Verlag: Birkhäuser Verlag

1997
Das Bundesland Niederösterreich, ehemals das Umland von Wien, hat im 20. Jahrhundert eine schrittweise Emanzipation vollzogen, was zuletzt in der Wahl St. Pöltens zur eigenen Hauptstadt (anstelle von Wien) und in der Folge im Bau eines entsprechenden Regierungsviertels kulminierte.
Die ländlich industriell
Hrsg: ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich
Autor: Walter Zschokke, Otto Kapfinger
Verlag: Birkhäuser Verlag

1997
Im September 1946 ist die Sustenpassstrasse, die in einschlägigen Kreisen damals schon als «Musterstück schweizerischer Strassenbaukunst» galt, nach achtjähriger Bauzeit offiziell eröffnet worden. Der Architekt Walter Zschokke zeigt, wie die Linienführung einer Strasse in die Landschaft integriert werden
Autor: Walter Zschokke
Verlag: gta Verlag

1996
Boris Podrecca, dessen umfangreiches Schaffen sich inhaltlich im Bereich der Pole Wien und Triest bewegt, liegt mit seinen auf organische Prozesse bezogenen und Lebensvorgänge interpretierenden Entwürfen weder im Trend einer zur Manier verkommenen «Neuen Einfachheit», noch folgen sie dem zum Dekorstil
Autor: Walter Zschokke
Verlag: Birkhäuser Verlag
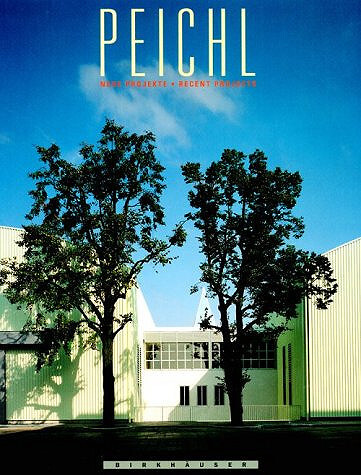
1996
Gustav Peichl gehört zu jenen international anerkannten österreichischen Architekten, «die das österreichische Selbstverständnis mitstilisiert haben» (Friedrich Achleitner). Unter seinen Arbeiten sind vor allem die Rundfunkstudios des ORF sowie die Bundeskunsthalle in Bonn international bekannt geworden.
Autor: Walter Zschokke, Gustav Peichl
Verlag: Birkhäuser Verlag