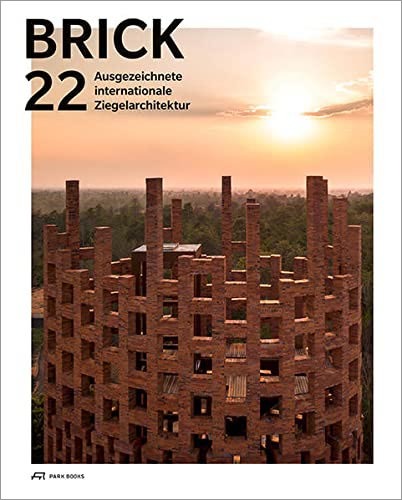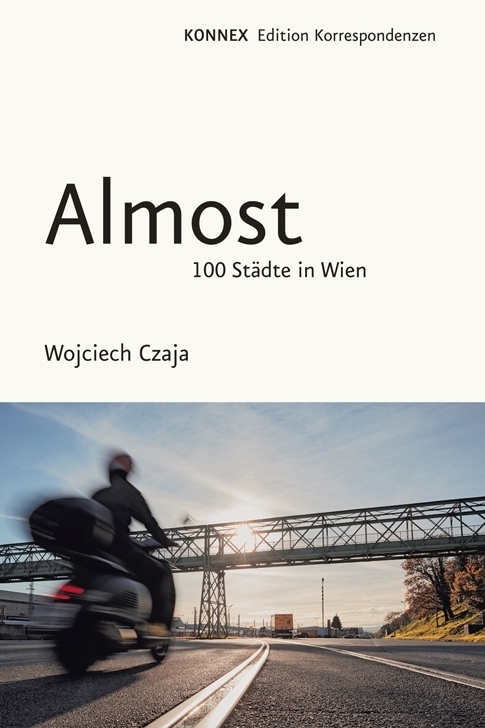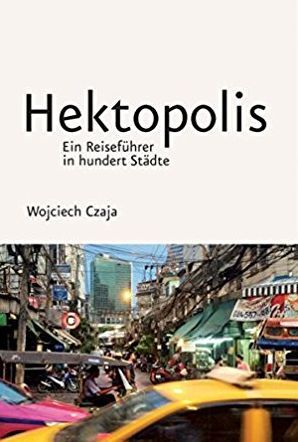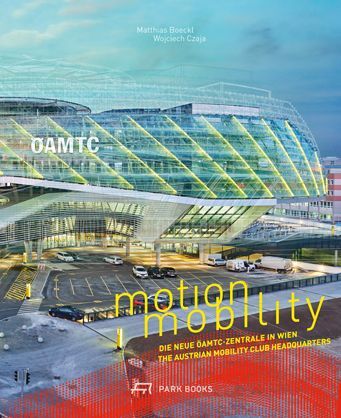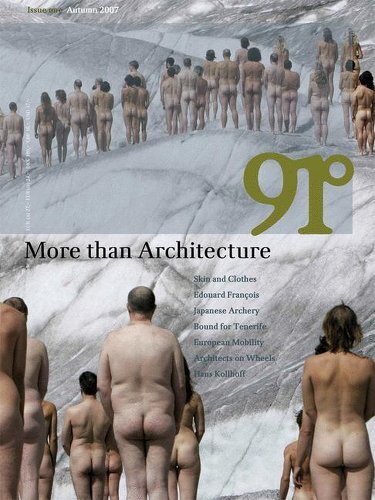Auf dünnem Eis
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina setzen auf Nachhaltigkeit, auch in der Architektur. Doch in einer zunehmend fragilen Landschaft wie den Alpen könnte auch das schon zu viel sein.
Für Fans, die sich sowohl für Sport als auch für Architektur begeistern, ist die Eröffnung der Olympischen Winterspiele mit Freude und Tränen verbunden. Das Stadion San Siro in Mailand, in dem am gestrigen Freitag die Eröffnungsfeier stattfand, ist dem Ende geweiht. Die 1925 errichtete und mehrfach erweiterte „Scala des Fußballs“ mit ihren wuchtigen roten Stahlträgern und schwindelerregenden Spiralrampen wird in den nächsten Jahren abgerissen und durch ein neues Stadion ersetzt, bei dem Megabauten-Allzweckwaffe Norman Foster seine Hand im Spiel hat.
Es dürfte nur ein kleiner Trost sein, dass die Stadt jetzt einen neuen olympischen Großbau bekommt, die Santagiulia Arena von David Chipperfield Architects und Arup Engineers. Gehüllt in eine bandartig herumwirbelnde Medienfassade, werden hier die Eishockeywettbewerbe stattfinden; nach den Spielen wird die Halle mit 16.000 Sitzplätzen für Konzerte und andere Sportereignisse genutzt.
Dem Wunsch nach einem architektonischen Symbol des Großereignisses ist damit Genüge getan. Nachdem Paris 2024 auf die Nutzung bestehender Sportstätten setzte, ist Nachhaltigkeit Pflicht für die Bewerbung beim Olympischen Komitee. Mit dem Versprechen, 93 Prozent der Wettbewerbe in bestehenden oder adaptierten Bauten durchzuführen, hatten Milano und Cortina den schwedischen Konkurrenten Stockholm Åre ausgestochen, der es nur auf 75 Prozent brachte.
Offizielles Ziel der Fondazione Milano Cortina 2026 ist es, einen Anstoß für nachhaltigen alpinen Tourismus zu liefern, mit Kreislaufwirtschaft, Wiederverwertung und Ressourceneffizienz. Die größte Alt-zu-Neu-Adaptierung erfuhr die Rho Fiera Milano, 2005 von Fuksas Architects erbaut. Ein Teil des 1.000.000 Quadratmeter großen Messehallen-Komplexes wird für Eishockey und Eisschnelllauf umgebaut. Kein kleiner Aufwand, da die permanente Kühlung riesiger Raumvolumen das olympische Energiebudget herausfordert.
Dolomitischer Zickzack
Schon im Oktober fertiggestellt war das Olympische Dorf, das der amerikanische Architektur-Großkonzern SOM auf einem ehemaligen Bahnareal direkt neben die Fondazione Prada von OMA (Rem Koolhaas) platzierte. Die achtgeschossigen Blocks werden nach den Spielen als Studierendenwohnheim für die nahe Università Boccioni dienen, und ihre recht simple Stapelung kleiner Zellen entspricht dem heute gängigen Standard der Wohnheim-Architektur. Bleibt zu hoffen, dass die „legacy“ hier besser funktioniert als in Turin, dessen Olympisches Dorf fast 20 Jahre brauchte, bis es seiner Nachnutzung zugeführt wurde.
Cortina d’Ampezzo, zweiter Schauplatz der Spiele, war bereits 1956 Austragungsort. Seitdem sind die Dolomiten zum Unesco-Welterbe erklärt worden, was der Notwendigkeit des schonenden Umgangs mit der Natur Nachdruck verleiht. Das Stadio Olimpico del Ghiaccio von den Architekten Mario Ghedina, Riccardo Nalli und Francesco Uras erfährt eine Wiederverwendung für die diesjährigen Curling-Wettbewerbe. Der U-formige Holzbau mit seiner dolomitischen Zickzack-Silhouette war schon in den frühen Nullerjahren vom Außen- zum verglasten Innenraum geworden, für 2026 kam noch eine temporäre Tribüne hinzu. Auch hier wurde ein Olympisches Dorf errichtet, die 1400 Athletinnen und Athleten werden aber in temporären Containern wohnen, die danach wieder abgebaut werden.
Doch nicht alle sind von den vollmundigen Nachhaltigkeitsbekundungen überzeugt. Eine Ö1-Radioreportage von Georg Bayerle sammelte Stimmen aus der lokalen Bevölkerung um Cortina, die die Region schon längst an der Grenze touristischer Belastung sehen. Millionenteure Beschneiung von Langlaufloipen und ein neuer Eiskanal, während 600 Kilometer weiter westlich in Cesana Torinese die Bobbahn von 2006 vor sich hin rottet. Nicht erst seit gestern stellen Kritiker und Klimaforscher die Frage, ob die fragilen Alpen, die von schmelzenden Gletschern und zerbröselnden Berggipfeln in ihrer Substanz angegriffen werden, als permanent optimiertes Sportgerät herhalten können. Benötigt der nicht gerade vor sich hin darbende alpine Tourismus wirklich noch einen Anstoß durch einen Großsportzirkus?
Instabile Höhenlagen
Die mehrfach belastete Gebirgslandschaft ist unter Dauerstress. Die Biodiversität schwindet, Gletscherschmelze und zerbröselnde Berggipfel sind auch für hartnäckigste Klimawandelleugner nicht zu übersehen. Laut IPCC erwärmen sich Gebirgsregionen etwa doppelt so stark wie der globale Durchschnitt, insbesondere die Südhänge und die Südseite der Alpen – dort, wo sich der olympische Wintersportzirkus abspielt. Teure und langfristige Infrastrukturen wie Straßen, Skigebiete, Speicherbecken und Schutzbauten geraten so in Widerspruch zu einer Landschaft, die in permanenter Bewegung ist. Dies zeigen auch Studien der European Environment Agency (EEA).
Jennifer Fauster, Cecilia Furlan und Emilie Stecher, Forscherinnen an der Wiener Boku, haben sich intensiv mit diesem Wandel auseinandergesetzt. Ihre Ausstellung Instabilities – The Shifting Alpine Landscape war auf der letzten Architekturbiennale in Venedig zu sehen. Sie deuten und visualisieren die Alpen als ein Territorium der Ausbeutung von Ressourcen, die durch Industrialisierung und Massentourismus aus dem Gleichgewicht geraten ist. „Die Alpen werden oft als beständiges Gebirge wahrgenommen: zeitlose Gipfel, reine Luft, widerstandsfähige Landschaften“, sagt Jennifer Fauster. „Doch dieses Bild ist eine sorgfältig gepflegte Illusion. Der Alpenbogen ist keine unberührte Kulisse der europäischen Moderne, sondern eine ihrer am intensivsten genutzten und umgestalteten Landschaften.“
Auch den „nachhaltigen“ Tourismus sehen die Forscherinnen nicht als heilendes Gegenmittel, sondern als Teil des Problems. „Landschaften werden anhand quantitativer Leistungskennzahlen bewertet – Energieertrag, Schneesicherheit, Besucherzahlen –, während ökologische Schwellenwerte weiter überschritten werden.“ Lösungsvorschlag der Forscherinnen: Die Alpen nicht noch weiter zu kolonisieren, sondern ihnen Raum zur Bewegung zu geben. In sportlicher Fairness.