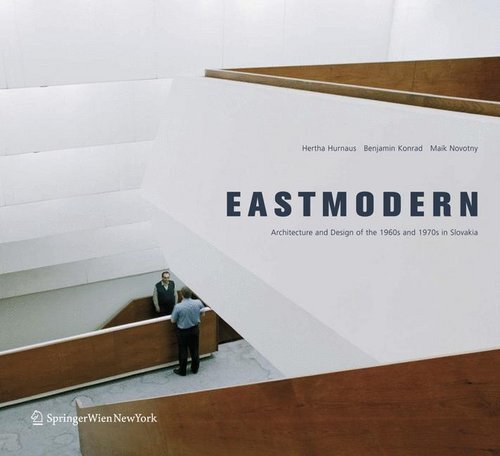Eine Stadt geht (nicht) baden
Klagenfurt hat seit vier Jahren kein Hallenbad und wird auch mindestens zwei weitere Jahre keines haben. Während im Skilift-Geschäft die Millionen herunterschneien, können sich viele Kommunen die Schwimm-Infrastruktur nicht mehr leisten.
Was gehört zum Grundzubehör einer Großstadt? Darauf gibt es unterschiedliche Antworten. Fans des Brettspiels Monopoly (hierzulande DKT) wissen, dass man dazu nicht mehr braucht als Häuser, Hotels, Banken, Bahnhöfe und ein Gefängnis. Für alles andere ist das kaufmännische Talent nicht zuständig. Spaziert man durch Österreichs sechstgrößte Stadt Klagenfurt, machen sich neben Häusern, Hotels und Banken eigene Prioritäten bemerkbar. Elf Solarien zählt die 105.000-Einwohner-Stadt, in etwa gleich viele Laufhäuser und Rotlichtbars, dafür rangiert die Zahl öffentlicher Büchereien bei exakt null.
Eine Null steht seit August 2021 auch hinter „öffentliches Hallenbad“, denn in jenem Sommer musste das Klagenfurter Bad schließen, nachdem ein Gutachter die Statik als bedenklich eingestuft hatte. Die Stadt und die Klagenfurter Stadtwerke STW, Betreiber des Bades, zeigten sich damals überrascht. Dabei galt das 1972 erbaute Bad schon lange als Sanierungsfall. Einen Plan B hatte man aber offensichtlich nicht in der Tasche, stattdessen hoffte man, es würde halt irgendwie weitergehen. Die Schulen waren verärgert, weil ihnen nun der Schwimmunterricht verunmöglicht war, die Schwimmvereine fürchteten um ihre Existenz, die Bürger protestierten.
Denn man war lange Zeit stolz auf das Bad. Mit einem Sportbecken von 33,5 mal 21 Metern, mit Plansch- und Lehrschwimmbecken und Sauna gehörte es bei der Eröffnung zu den größten Schwimmsportzentren Österreichs. Der Entwurf des Villacher Architekturbüros Bauer mit seinem abgestuften Dach war zurückhaltend modern, veredelt durch Kunst am Bau von Valentin Oman und Giselbert Hoke. In den 1990er-Jahren wurde das Bad von Sport in Richtung Rutschspaß adaptiert, das Becken auf 25 Meter Länge verkürzt. 2015 leistete man sich eine neue Rutsche für 100.000 Euro.
Keine Sanierung
Praktisch jedes Gebäude kommt mit etwa 40 Jahren ins sanierungsfällige Alter, bei Hallenbädern kommt die Beanspruchung durch Feuchtigkeit und Chlor noch hinzu. Eine Sanierung wollte man in Klagenfurt allerdings nicht angehen, stattdessen entschied man sich für einen Neubau an anderem Ort. Mehrere Standorte wurden ins Spiel gebracht, ein Bürgerrat an der Entscheidung beteiligt, bis die Wahl auf ein Areal am südwestlichen Stadtrand neben dem Stadion fiel. Das ist einerseits sinnvoll, da dort bereits eine Sport-Infrastruktur vorhanden ist, andererseits nicht sinnvoll, weil künftig alle Schülerinnen und Schüler mit dem Bus zum Schwimmunterricht fahren müssen.
Den internationalen Wettbewerb für das neue „Alpe-Adria-Sportbad“ gewann im Jänner 2023 das Atelier Thomas Pucher aus Graz mit einem flachen, mehrfach geschwungenen und nicht uneleganten Entwurf. Laut STW sollte noch im selben Jahr mit dem Bau begonnen werden und Ende 2024 der Probebetrieb starten. Dem war nicht so.
Denn Klagenfurt ist finanziell vom Schwimmen ins Trudeln geraten. Im Juni 2025 warnte der Konsolidierungsbeirat der Stadt, bei der Umsetzung des 68 Millionen Euro teuren Hallenbadprojekts und ohne gegensteuernde Maßnahmen drohe spätestens im ersten Quartal 2026 die Zahlungsunfähigkeit. Sollte die Stadt also für immer hallenbadlos und sollten Generationen von Kindern Nichtschwimmer bleiben?
Sollen sie nicht. Im September dieses Jahres wurde die Finanzierung des Neubaus beschlossen. Die Stadt Klagenfurt nahm einen Kredit mit 30 Jahren Laufzeit auf und zahlt 50 Millionen, wovon sechs bereits für die Planung ausgegeben wurden. Das Land Kärnten trägt sieben Millionen bei, zweckgewidmet für das 50 mal 25 Meter große Sportbecken. Weitere sieben Millionen kommen vom Bund, der Rest von Förderungen. Die STW investieren zusätzlich 4,6 Millionen Euro in die Errichtung des Olympiazentrums. Mitte Oktober erfolgte der Spatenstich, der tatsächliche Baubeginn wird jedoch erst 2026 stattfinden, der erste Sprung vom Startblock ins Wasser soll 2028 erfolgen, also fast sieben Jahre nach der Schließung des alten Bades.
Doch was passiert währenddessen eigentlich mit dem alten Bad? Im September 2022 wurde das gesamte Areal für neun Millionen Euro an die Grazer Bietergemeinschaft der Bauträger GWS und Haring Group verkauft, die hier unter dem Projektnamen „Green Canyon“ 160 Wohnungen errichten will. Bislang ist allerdings nichts passiert. Im April dieses Jahres vermeldete die Kleine Zeitung , es gebe Anzeichen, dass die Käufer den Kauf rückabwickeln wollten. Auf Anfrage des ΔTANDARD bei den STW heißt es, man arbeite derzeit an einer gemeinsamen Lösung.
Nun hat Klagenfurt null Hallenbäder, dafür bald zwei Baustellen. Was hätte man besser machen können? Zum Beispiel das alte Bad zu etwas Neuem machen, wie der Architekt Lukas Vejnik sagt, der seit vielen Jahren zur Nachkriegsmoderne in Kärnten forscht. „Das bestehende Hallenbad mag vielleicht als Bad nicht mehr betriebsfähig sein, aber es könnte Potenzial für andere Nutzungen bieten, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt. Für solche intelligenten Umnutzungen gibt es international einige Beispiele.“ Im niederländischen Gouda etwa wurde ein denkmalgeschütztes Bad aus dem Jahr 1931 zu einem Wohnbau, mit dem Schwimmbecken als Gemeinschaftsgarten.
Adieu, Zehnmeterbrett
Dass Klagenfurt nicht die einzige Stadt ist, in der die Grundversorgung für den Schwimmsport zerbröselt, zeigte im September der ORF-Bericht Badeschluss – das Ende der Schwimmbäder. Während die Alpengipfel mit lukrativen Skiliften bestückt werden, können sich viele Kommunen Betrieb und Sanierung von Bädern nicht mehr leisten.
Das betrifft nicht nur die Hallenbäder. In Ternitz, das mit dem Parkbad (inzwischen zum „blub“ verniedlicht) einen elegant modernen Entwurf von Roland Rainer aus dem Jahr 1959 sein Eigen nennt, soll kommende Woche der Gemeinderatsbeschluss zum Abbruch des Zehn-Meter-Sprungturms gefällt werden, nachdem dieser nur noch bis zur Höhe des Einmeterbretts benutzbar war und das Bundesdenkmalamt ihn als „nicht erhaltenswert“ eingestuft hatte.
Dabei gäbe es Vorbilder, wie man solche Objekte sanieren kann. Der Sprungturm am Millstätter See aus dem Jahr 1931, ein luftig-expressives Gebilde aus Sichtbeton, das selbst Höhenangstgeplagten Lust auf einen Köpfler macht, wurde von Hohengasser Wirnsberger Architekten sensibel saniert, ohne dass heutige Sicherheitsanforderungen die Eleganz zunichtemachen. Beim Kärntner Landesbaupreis gab es dafür eine Anerkennung. Es geht also, wenn man nur will.