Veranstaltung
The Guggenheim Collection
Ausstellung
21. Juli 2006 bis 7. Januar 2007
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH
Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
D-53113 Bonn
Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
D-53113 Bonn
Veranstalter:in: Bundeskunsthalle Bonn
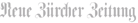
Meisterwerke und Visionen
Die Bundeskunsthalle in Bonn zeigt «Guggenheim Architecture»
Eine Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn widmet sich der Architektur der Guggenheim-Museen. Vorgestellt werden neben Frank Lloyd Wrights New Yorker Hauptsitz und Frank Gehrys Neubau in Bilbao auch die zahlreichen unrealisierten Guggenheim-Projekte in aller Welt.
13. Oktober 2006 - Ulf Meyer
Es gibt zwei Museen, die eindrücklich beweisen, welche Bildkraft meisterhafte Architektur für ein weltweites Publikum entfalten kann: die weisse Spirale des Guggenheim-Museums in New York und dessen Filiale im baskischen Bilbao. Das zwischen 1943 und 1959 nach Plänen von Frank Lloyd Wright realisierte Stammhaus an der Fifth Avenue wirkt ebenso wie ein gebautes Markenzeichen des global agierenden Kulturunternehmens Guggenheim wie das 1997 eröffnete architektonische Gewitter aus Stahl, Stein und Titanblech am Ufer des Nervión. Ohne diese beiden markanten Bauten wäre die Sammlung des Museums wohl kaum weltberühmt geworden. Andere Projekte des Guggenheim-Museums waren allerdings weniger erfolgreich: So hat dessen Direktor Thomas Krens ein Neubauprojekt nach dem anderen geplant - und dann zu Grabe getragen.
Enthusiastische Baukünstler
Knapp fünfzig Jahre nach der Eröffnung des New Yorker Hauptsitzes widmet sich das Guggenheim- Museum erstmals in einer grossen Ausstellung dem architektonischen Engagement der Institution Guggenheim. Die vielen nie gebauten Museen illustrieren dabei das Vorgehen des Museumskonzerns: Ort und Architekt der neu geplanten Guggenheim-Filialen sind austauschbar, solange sie bekannt genug sind. In Salzburg sollte der örtliche Ableger in den Mönchsberg hinein gebaut werden, in Guadalajara oberhalb der Stadt auf einem steilen Felsen thronen und in Tokio weit in die Bucht hinausragen. Kaum zeigten sich aber Schwierigkeiten, gab Krens jeweils die Entwürfe auf. Weder dem Museum noch den beteiligten Politikern oder Architekten sind diese Misserfolge jedoch peinlich. Im Gegenteil, es scheint zum guten Ton zu gehören, mindestens ein Guggenheim-Museum irgendwo auf der Welt entworfen zu haben: Von Asymptote über Shigeru Ban, Vittorio Gregotti, Hans Hollein und Arata Isozaki bis Rem Koolhaas reicht die Liste der Guggenheim-Planer. Jean Nouvel und Zaha Hadid haben ihr Glück sogar schon mehrmals erfolglos probiert - doch weder in Guadalajara oder Rio de Janeiro noch in Singapur, Taichung oder Tokio war letztlich ein ernsthafter Bauherr dauerhaft für die Kolonien des Guggenheim-Konzerns zu begeistern.
Dass sich die Guggenheim-Stiftung die Bundeskunsthalle in Bonn als Ort ihrer baukünstlerischen Nabelschau ausgesucht hat, hängt mit dem Sponsor der Schau zusammen, dessen Hauptsitz sich in der Nachbarschaft des Bonner Ausstellungshauses befindet. Aber es gibt auch eine kunstgeschichtliche Verbindung zwischen New York und Deutschland: Schliesslich war es die deutsche Künstlerin Hilla von Rebay, die nach Stationen in Zürich und Paris in New York beim Porträtieren den Kupfermagnaten Solomon Guggenheim kennenlernte. Dessen Familie stammte aus Lengnau im Kanton Aargau, emigrierte 1848 nach Philadelphia und investierte in die Silberminen von Colorado und bald auch in Mexiko, Alaska und Chile. Rebay konnte Guggenheim mit nahezu religiösem Eifer davon überzeugen, bei seinen Kunstkäufen ganz auf Wassily Kandinsky und die gegenstandslose europäische Avantgarde zu setzen. Es war auch Hilla von Rebay, die Frank Lloyd Wright beauftragte, einen «Tempel des Geistes» für die Guggenheim-Stiftung zu bauen. Sie wünschte sich ein «rundes Museum ohne Treppen, Fenster und feste Räume». In Wrights Schneckenhaus fahren die Besucher mit dem Lift nach oben, schlendern dann auf einer spiralförmigen Rampe hinunter und geniessen die Kunst en passant. Die Spirale hat Wright in über 700 Zeichnungen entwickelt, von denen einige in der Bonner Schau zu sehen sind. Das New Yorker Museum wurde bald populärer als die Kunst, die es beherbergt: Der Rahmen wurde wichtiger als das Bild.
Eleganter Projektfriedhof
Im Jahr 1992 wurde das New Yorker Museum nach Entwürfen von Charles Gwathmey um einen scheibenförmigen Turm erweitert. Doch damit war der Expansionsdrang des Guggenheim-Imperiums nicht gestillt: In SoHo wurde eine Dépendance eröffnet (und bald wieder geschlossen). Ihr folgten 1997 eine mit Hilfe der Deutschen Bank ermöglichte Niederlassung in Berlin und eine Filiale in einem Spielkasino in Las Vegas. Gut zwei Dutzend Entwürfe für Museumsneubauten hat die Stiftung zusätzlich in Auftrag gegeben, die allesamt scheiterten, darunter ein skulpturales Monument von Gehry in Lower Manhattan, das nach den Attentaten auf das World Trade Center sang- und klanglos gestrichen wurde. Die von Peter Noever vom Wiener Museum für Angewandte Kunst (MAK) kuratierte Schau in Bonn zeigt die Pläne für all die unrealisierten Bauten zu einem eleganten Projektfriedhof arrangiert, aus dessen Dunkel die strahlenden Modelle wie exotische Gewächse eines überambitionierten Bauherrn hervorzuwachsen scheinen.
[ Bis 12. November. - Kurzführer: The Guggenheim Architecture. Bundeskunsthalle, Bonn 2006. 64 S., Euro 6.50. - Symposium zum «Bilbao-Effekt» am 17. Oktober. ]
Enthusiastische Baukünstler
Knapp fünfzig Jahre nach der Eröffnung des New Yorker Hauptsitzes widmet sich das Guggenheim- Museum erstmals in einer grossen Ausstellung dem architektonischen Engagement der Institution Guggenheim. Die vielen nie gebauten Museen illustrieren dabei das Vorgehen des Museumskonzerns: Ort und Architekt der neu geplanten Guggenheim-Filialen sind austauschbar, solange sie bekannt genug sind. In Salzburg sollte der örtliche Ableger in den Mönchsberg hinein gebaut werden, in Guadalajara oberhalb der Stadt auf einem steilen Felsen thronen und in Tokio weit in die Bucht hinausragen. Kaum zeigten sich aber Schwierigkeiten, gab Krens jeweils die Entwürfe auf. Weder dem Museum noch den beteiligten Politikern oder Architekten sind diese Misserfolge jedoch peinlich. Im Gegenteil, es scheint zum guten Ton zu gehören, mindestens ein Guggenheim-Museum irgendwo auf der Welt entworfen zu haben: Von Asymptote über Shigeru Ban, Vittorio Gregotti, Hans Hollein und Arata Isozaki bis Rem Koolhaas reicht die Liste der Guggenheim-Planer. Jean Nouvel und Zaha Hadid haben ihr Glück sogar schon mehrmals erfolglos probiert - doch weder in Guadalajara oder Rio de Janeiro noch in Singapur, Taichung oder Tokio war letztlich ein ernsthafter Bauherr dauerhaft für die Kolonien des Guggenheim-Konzerns zu begeistern.
Dass sich die Guggenheim-Stiftung die Bundeskunsthalle in Bonn als Ort ihrer baukünstlerischen Nabelschau ausgesucht hat, hängt mit dem Sponsor der Schau zusammen, dessen Hauptsitz sich in der Nachbarschaft des Bonner Ausstellungshauses befindet. Aber es gibt auch eine kunstgeschichtliche Verbindung zwischen New York und Deutschland: Schliesslich war es die deutsche Künstlerin Hilla von Rebay, die nach Stationen in Zürich und Paris in New York beim Porträtieren den Kupfermagnaten Solomon Guggenheim kennenlernte. Dessen Familie stammte aus Lengnau im Kanton Aargau, emigrierte 1848 nach Philadelphia und investierte in die Silberminen von Colorado und bald auch in Mexiko, Alaska und Chile. Rebay konnte Guggenheim mit nahezu religiösem Eifer davon überzeugen, bei seinen Kunstkäufen ganz auf Wassily Kandinsky und die gegenstandslose europäische Avantgarde zu setzen. Es war auch Hilla von Rebay, die Frank Lloyd Wright beauftragte, einen «Tempel des Geistes» für die Guggenheim-Stiftung zu bauen. Sie wünschte sich ein «rundes Museum ohne Treppen, Fenster und feste Räume». In Wrights Schneckenhaus fahren die Besucher mit dem Lift nach oben, schlendern dann auf einer spiralförmigen Rampe hinunter und geniessen die Kunst en passant. Die Spirale hat Wright in über 700 Zeichnungen entwickelt, von denen einige in der Bonner Schau zu sehen sind. Das New Yorker Museum wurde bald populärer als die Kunst, die es beherbergt: Der Rahmen wurde wichtiger als das Bild.
Eleganter Projektfriedhof
Im Jahr 1992 wurde das New Yorker Museum nach Entwürfen von Charles Gwathmey um einen scheibenförmigen Turm erweitert. Doch damit war der Expansionsdrang des Guggenheim-Imperiums nicht gestillt: In SoHo wurde eine Dépendance eröffnet (und bald wieder geschlossen). Ihr folgten 1997 eine mit Hilfe der Deutschen Bank ermöglichte Niederlassung in Berlin und eine Filiale in einem Spielkasino in Las Vegas. Gut zwei Dutzend Entwürfe für Museumsneubauten hat die Stiftung zusätzlich in Auftrag gegeben, die allesamt scheiterten, darunter ein skulpturales Monument von Gehry in Lower Manhattan, das nach den Attentaten auf das World Trade Center sang- und klanglos gestrichen wurde. Die von Peter Noever vom Wiener Museum für Angewandte Kunst (MAK) kuratierte Schau in Bonn zeigt die Pläne für all die unrealisierten Bauten zu einem eleganten Projektfriedhof arrangiert, aus dessen Dunkel die strahlenden Modelle wie exotische Gewächse eines überambitionierten Bauherrn hervorzuwachsen scheinen.
[ Bis 12. November. - Kurzführer: The Guggenheim Architecture. Bundeskunsthalle, Bonn 2006. 64 S., Euro 6.50. - Symposium zum «Bilbao-Effekt» am 17. Oktober. ]
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom






