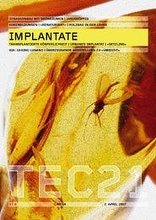Zeitschrift
TEC21 2007|14
Implantate

Transplantierte Körperlichkeit
Die Architektur hat immer schon sprachliche und inhaltliche Anleihen bei der Medizin gemacht. Doch die «Verleiblichung der Architektur» ist auch eine Rückwirkung des medizinischen «Body-Engineering».[1]
2. April 2007 - Rahel Hartmann Schweizer
Implantate, die keine Fremdkörper mehr sind, die keine Immunreaktionen auslösen und vom Organismus nicht mehr abgestossen werden, sind der Stolz der Mediziner. Bioaktive Implantate, die den Körper anregen, nachzuproduzieren, was bei einer Operation oder durch Verschleiss in Mitleidenschaft gezogen oder gar zerstört wurde, Gewebe zu regenerieren – etwa die Neubildung von Knochengewebe stimulieren, das bei der Entfernung eines Tumors angegriffen wurde – beflügeln ihren Ehrgeiz. So sehr, dass sie sprachliche Anleihe bei der Architektur nehmen: «Knochenaufbau und Weichgeweberegeneration, auch dies sind ‹architektonische Meisterstücke›, die, wie bei einem Bauwerk, der Funktionalität und Ästhetik dienen.» [2]
Tissue Engineering ist das Zauberwort. Es meint die Kombination von Hightechmaterialien mit Zellkulturen zur Züchtung von Gewebe, von der Zellentnahme am Patienten bis zur Kultivierung eines vollständigen Organs. Um Gewebe und Organe – Herzklappen oder Adern etwa – durch dreidimensionale Implantate zu ersetzen, wird eine extrazelluläre Matrix (EZM) erstellt, die die neu wachsenden Gewebezellen beherbergt. Trägermaterialien sollen bioverträglich, steril, je nach Anwendung langzeitstabil oder bioabbaubar und unterschiedlich flexibel sein. Als Ausgangsmaterial dienen Kunststoffe, anorganische Substrate und aus biologischem Material gewonnene Gerüstsubstrate, meistens Kollagen. Das Resultat sind schwammartige Schichten, wässrige und gummiartige Gele, zementharte Träger und flexible, faserhaltige Röhren.[3]
Gewachsenes Material
Die Behandlung von Hautverletzungen gilt als das bislang erfolgreichste Anwendungsgebiet für das Tissue Engineering. Das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung schätzt, dass in Europa rund 25 000 Menschen mit in vitro gezüchteten Haut-, Knorpel- und Knochenzellen leben. Zur Hautregeneration wird eine bioabbaubare poröse Matrix verwendet, in die Makrophagen, Fibroblasten, Lymphozyten und Gefässe eindringen können – Komponenten, die für die Wundheilung wichtig sind. Mit einer Schicht dieses Materials wird die Wunde bedeckt und mit einer Silikonfolie geschlossen. Nachdem sich die Gewebebasis regeneriert hat, entfernt man die Silikonschicht und transplantiert eine in vitro kultivierte Ersatzhaut. Paradebeispiel für die Wiederherstellung eines ganzen Körperteils durch Tissue Engineering ist das Ohr. Dabei wird eine wie ein Ohr geformte Matrix mit patienteneigenen Chondrozyten (Knorpelzellen) besiedelt. Freiburger Mediziner verpflanzten einem Patienten einen im Labor hergestellten Ohrknorpel. Zur Rekonstruktion seines verstümmelten Ohres waren ihm Knorpelzellen aus einer Rippe entnommen worden. Die Zellen wurden in Kultur vermehrt, zusammen mit Fibrin («Klebstoff» der plasmatischen Blutgerinnung) in Ohrform gegossen, transplantiert und mit einem Hautlappen überzogen.
Die Herzklappen-Prothese ist ein anderes Beispiel. Mit Unterstützung des Nationalen Forschungsprogramms «Implantate und Transplantate» ist es am Zürcher Universitätsspital gelungen, aus Stammzellen, die aus menschlichem Fruchtwasser gewonnen wurden, lebende Herzklappen zu züchten. Diese können nach der Implantation mit dem Körper mitwachsen (Bild 4).
Regenerativ, adaptiv, sensitiv
Das Pendant zu den regenerativen Materialien der Medizin sind im Bauwesen die adaptiven Werkstoffe. Adaptive Werkstoffsysteme – auch intelligente Werkstoffe, multifunktionale Werkstoffe, Adaptronics oder Smart Materials genannt – sind in der Lage, während des Einsatzes selbstständig auf Änderungen der Umgebungsbedingungen zu reagieren und ihre Eigenschaften anzupassen.[4] Multifunktionale Verbundwerkstoffe etwa werden entwickelt, die Schwingungen dämmen und den damit verbundenen Lärm reduzieren: Sensoren registrieren, wann das Material in Schwingung gerät. Das Sensorsignal wird von einem Regler verarbeitet, der die integrierten Aktuatoren so ansteuert, dass die Bewegung abgedämpft wird. Dabei werden mikrometerfeine
piezoelektrische Fasern aus Keramik genutzt, die mechanische oder thermische Spannungen in elektrische Signale umsetzen. Umgekehrt können sich die Fasern dehnen oder zusammenziehen, wenn eine elektrische Ladung angelegt wird (Bild 7). Im Ingenieurwesen ist das Implantat aber längst etabliert. Die Betonierung des Sockels des berühmten schiefen Turms von St. Moritz, die mittels Verputz kaschiert wird (Bild 9), ist ebenso als Implantat zu verstehen wie die nachträgliche Vorspannung von Brücken, wie sie etwa an der Sihlhochstrasse mittels Zugstangen bewerkstelligt wurde, oder wie nachträgliche Klebearmierungen, um Wände zu verstärken.
Pulsierende Stadt
Auch der Architektur selber rückt man längst schon mit Körper-Metaphern auf den Leib. In der Renaissance zwangen Proportionsstudien den menschlichen Körper ins architektonische Korsett. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird die Anleihe konkreter: Adolf Loos’ Michaeler Haus in Wien (1910), das «aufgrund seiner weissen, für die damalige Zeit ungewöhnlich ornamentlosen Fassade in den oberen Wohngeschossen, (…) in den Betrachtern Bilder von Kahlheit und Nacktheit (weckte); in der Presse war jedoch auch die Rede vom ‹nackten Oberbau›, einer ‹ungeschlachten drallen Dirne› oder dem ‹Haus ohne Unterleib›.»[5]
Damals war das Implantat die Tätowierung der Haut, heute ist es die mit dem Lotos-Effekt ausgerüstete Fassade oder gar die adaptive, mit einem Adern- oder Nervensystem ausgestattete Gebäudehülle des Projekts «Paul» von Werner Sobek und Markus Holzbach, die sich die Haut als ein sensitives Organ zum Vorbild genommen hat, die den Wärmehaushalt im Innern reguliert.[6]
Die Stadt wird zur pulsierenden Metropole, deren Gefässe aber auch schon verstopft sind. Le Corbusier schrieb von der «fruchtlosen Operation», in Paris «riesige Massen baufälliger Häuser» niederzureissen und «auf den so gewonnenen Terrains ‹Buildings›» zu errichten: «Man lässt es geschehen, man lässt über der alten Stadt, die das Leben mordete, eine neue Stadt aufrichten, die das Leben um so viel unfehlbarer morden wird, als sie wahre Knoten von Verstopfung bildet, ohne die Strasse irgend umzuwandeln.»[7] Heute wird die Verstopfung mit dem «Bypass» behoben. Jüngstes Projekt eines solchen Implantats ist der Bypass Thun Nord, der die Thuner Innenstadt vom Verkehr entlasten und gleichzeitig Entwicklungsgebiete erschliessen soll (siehe Seiten 8–9).
Die Stadt wird als Organismus begriffen, dessen schädliche Wucherungen mit dem Skalpell entfernt und durch Implantate ersetzt werden, die mit dem Stadtkörper amalgieren sollen, damit die Wundränder verheilen. Der Palast der Republik in Berlin war eine solche Geschwulst, die es auszumerzen galt und die nun mit dem Wiederaufbau des Schlosses geheilt werden soll. Gewaltsam eine Wunde geschlagen hat die Terrorattacke 2001 in New York. Sie klafft noch immer, weil das Implantat wohl zu sehr aufgeladen wurde – Arterien als Verkehrsverbindungen, Zellen für Büros, ein Stoffwechselorgan des sozialen Austauschs, Synapsen der Erinnerung.
Der Flon in Lausanne galt als fast abgestorbenes Organ, das der Wiederbelebung bedurfte. Der Fussgänger-Bypass – das «Interface-Flon» von Bernard Tschumi und Luca Merlini – ist schon gelegt (Bild 6). Und statt des einstigen Flusses durchzieht das Quartier bald die Arterie der Metro: eine Operation am offenen Herzen, denn noch klaffen riesige Baulücken, die nach und nach aufgefüllt werden. Manchmal jedoch reichen auch homöopathische Dosen, die Renovation eines Gebäudes und seine Um- oder Wiedernutzung, wie etwa beim Cabaret Voltaire in Zürich.
Genius loci – soziokulturelle Matrix
Architektonische Implantate können mit dem Stadtkörper verwachsen – etwa, wenn wie in Bilbao das umliegende Terrain einbezogen, die Ader des Flusses revitalisiert wird und Brücken wie Gefässe das neue Organ versorgen – oder auch nur, wenn körpereigene Zellen transplantiert werden –, die Treppe in der Erweiterung des Kunsthauses Aarau von Herzog & de Meuron als Referenz an die existierende Spindel, die Adaption der traditionellen Azulejos in OMAs Casa da Musica in Porto, die ansonsten auch mit einem Meteoriten verglichen wurde. Und als solcher kann der Fremdkörper natürlich auch einen Virus einschleppen. Aber anders als in der Medizin lassen sich eine Stadt und ihre Bewohner zuweilen gern von ihm infizieren, anstecken von dem Neuen, das zum Körpereigenen mutieren kann.
Doch die medizinischen Metaphern implizieren auch potenzielle soziale Abstossungsreaktionen des Stadtkörpers, des durch Menschen belebten Organismus, die den kulturellen Austausch ausmachen. Denn «dieselben» Makrophagen und Lymphozyten, welche die Wundheilung fördern, stellen auch die Immunabwehr: «Ob Gehrys Wunderbau der Stadt tatsächlich ein kulturelles Herz einpflanzen kann, obwohl die Büromenschen nach Dienstschluss auf dem schnellsten Weg zu den Parkplätzen hasten, die wenigen Take-away-Schnellrestaurants ihre Rollläden herunterlassen und der Distrikt sich nach Einbruch der Dunkelheit in ein zugiges, unwirtliches Revier verwandelt?», fragte sich Claus Spahn angesichts der von Frank O. Gehry in Los Angeles gebauten Walt Disney Concert Hall.[8]
Wenn der gesellschaftliche Kitt, die soziokulturelle Matrix versagt, fehlt der Nährboden. Das Implantat verkümmert und muss eines Tages amputiert werden...
Tissue Engineering ist das Zauberwort. Es meint die Kombination von Hightechmaterialien mit Zellkulturen zur Züchtung von Gewebe, von der Zellentnahme am Patienten bis zur Kultivierung eines vollständigen Organs. Um Gewebe und Organe – Herzklappen oder Adern etwa – durch dreidimensionale Implantate zu ersetzen, wird eine extrazelluläre Matrix (EZM) erstellt, die die neu wachsenden Gewebezellen beherbergt. Trägermaterialien sollen bioverträglich, steril, je nach Anwendung langzeitstabil oder bioabbaubar und unterschiedlich flexibel sein. Als Ausgangsmaterial dienen Kunststoffe, anorganische Substrate und aus biologischem Material gewonnene Gerüstsubstrate, meistens Kollagen. Das Resultat sind schwammartige Schichten, wässrige und gummiartige Gele, zementharte Träger und flexible, faserhaltige Röhren.[3]
Gewachsenes Material
Die Behandlung von Hautverletzungen gilt als das bislang erfolgreichste Anwendungsgebiet für das Tissue Engineering. Das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung schätzt, dass in Europa rund 25 000 Menschen mit in vitro gezüchteten Haut-, Knorpel- und Knochenzellen leben. Zur Hautregeneration wird eine bioabbaubare poröse Matrix verwendet, in die Makrophagen, Fibroblasten, Lymphozyten und Gefässe eindringen können – Komponenten, die für die Wundheilung wichtig sind. Mit einer Schicht dieses Materials wird die Wunde bedeckt und mit einer Silikonfolie geschlossen. Nachdem sich die Gewebebasis regeneriert hat, entfernt man die Silikonschicht und transplantiert eine in vitro kultivierte Ersatzhaut. Paradebeispiel für die Wiederherstellung eines ganzen Körperteils durch Tissue Engineering ist das Ohr. Dabei wird eine wie ein Ohr geformte Matrix mit patienteneigenen Chondrozyten (Knorpelzellen) besiedelt. Freiburger Mediziner verpflanzten einem Patienten einen im Labor hergestellten Ohrknorpel. Zur Rekonstruktion seines verstümmelten Ohres waren ihm Knorpelzellen aus einer Rippe entnommen worden. Die Zellen wurden in Kultur vermehrt, zusammen mit Fibrin («Klebstoff» der plasmatischen Blutgerinnung) in Ohrform gegossen, transplantiert und mit einem Hautlappen überzogen.
Die Herzklappen-Prothese ist ein anderes Beispiel. Mit Unterstützung des Nationalen Forschungsprogramms «Implantate und Transplantate» ist es am Zürcher Universitätsspital gelungen, aus Stammzellen, die aus menschlichem Fruchtwasser gewonnen wurden, lebende Herzklappen zu züchten. Diese können nach der Implantation mit dem Körper mitwachsen (Bild 4).
Regenerativ, adaptiv, sensitiv
Das Pendant zu den regenerativen Materialien der Medizin sind im Bauwesen die adaptiven Werkstoffe. Adaptive Werkstoffsysteme – auch intelligente Werkstoffe, multifunktionale Werkstoffe, Adaptronics oder Smart Materials genannt – sind in der Lage, während des Einsatzes selbstständig auf Änderungen der Umgebungsbedingungen zu reagieren und ihre Eigenschaften anzupassen.[4] Multifunktionale Verbundwerkstoffe etwa werden entwickelt, die Schwingungen dämmen und den damit verbundenen Lärm reduzieren: Sensoren registrieren, wann das Material in Schwingung gerät. Das Sensorsignal wird von einem Regler verarbeitet, der die integrierten Aktuatoren so ansteuert, dass die Bewegung abgedämpft wird. Dabei werden mikrometerfeine
piezoelektrische Fasern aus Keramik genutzt, die mechanische oder thermische Spannungen in elektrische Signale umsetzen. Umgekehrt können sich die Fasern dehnen oder zusammenziehen, wenn eine elektrische Ladung angelegt wird (Bild 7). Im Ingenieurwesen ist das Implantat aber längst etabliert. Die Betonierung des Sockels des berühmten schiefen Turms von St. Moritz, die mittels Verputz kaschiert wird (Bild 9), ist ebenso als Implantat zu verstehen wie die nachträgliche Vorspannung von Brücken, wie sie etwa an der Sihlhochstrasse mittels Zugstangen bewerkstelligt wurde, oder wie nachträgliche Klebearmierungen, um Wände zu verstärken.
Pulsierende Stadt
Auch der Architektur selber rückt man längst schon mit Körper-Metaphern auf den Leib. In der Renaissance zwangen Proportionsstudien den menschlichen Körper ins architektonische Korsett. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird die Anleihe konkreter: Adolf Loos’ Michaeler Haus in Wien (1910), das «aufgrund seiner weissen, für die damalige Zeit ungewöhnlich ornamentlosen Fassade in den oberen Wohngeschossen, (…) in den Betrachtern Bilder von Kahlheit und Nacktheit (weckte); in der Presse war jedoch auch die Rede vom ‹nackten Oberbau›, einer ‹ungeschlachten drallen Dirne› oder dem ‹Haus ohne Unterleib›.»[5]
Damals war das Implantat die Tätowierung der Haut, heute ist es die mit dem Lotos-Effekt ausgerüstete Fassade oder gar die adaptive, mit einem Adern- oder Nervensystem ausgestattete Gebäudehülle des Projekts «Paul» von Werner Sobek und Markus Holzbach, die sich die Haut als ein sensitives Organ zum Vorbild genommen hat, die den Wärmehaushalt im Innern reguliert.[6]
Die Stadt wird zur pulsierenden Metropole, deren Gefässe aber auch schon verstopft sind. Le Corbusier schrieb von der «fruchtlosen Operation», in Paris «riesige Massen baufälliger Häuser» niederzureissen und «auf den so gewonnenen Terrains ‹Buildings›» zu errichten: «Man lässt es geschehen, man lässt über der alten Stadt, die das Leben mordete, eine neue Stadt aufrichten, die das Leben um so viel unfehlbarer morden wird, als sie wahre Knoten von Verstopfung bildet, ohne die Strasse irgend umzuwandeln.»[7] Heute wird die Verstopfung mit dem «Bypass» behoben. Jüngstes Projekt eines solchen Implantats ist der Bypass Thun Nord, der die Thuner Innenstadt vom Verkehr entlasten und gleichzeitig Entwicklungsgebiete erschliessen soll (siehe Seiten 8–9).
Die Stadt wird als Organismus begriffen, dessen schädliche Wucherungen mit dem Skalpell entfernt und durch Implantate ersetzt werden, die mit dem Stadtkörper amalgieren sollen, damit die Wundränder verheilen. Der Palast der Republik in Berlin war eine solche Geschwulst, die es auszumerzen galt und die nun mit dem Wiederaufbau des Schlosses geheilt werden soll. Gewaltsam eine Wunde geschlagen hat die Terrorattacke 2001 in New York. Sie klafft noch immer, weil das Implantat wohl zu sehr aufgeladen wurde – Arterien als Verkehrsverbindungen, Zellen für Büros, ein Stoffwechselorgan des sozialen Austauschs, Synapsen der Erinnerung.
Der Flon in Lausanne galt als fast abgestorbenes Organ, das der Wiederbelebung bedurfte. Der Fussgänger-Bypass – das «Interface-Flon» von Bernard Tschumi und Luca Merlini – ist schon gelegt (Bild 6). Und statt des einstigen Flusses durchzieht das Quartier bald die Arterie der Metro: eine Operation am offenen Herzen, denn noch klaffen riesige Baulücken, die nach und nach aufgefüllt werden. Manchmal jedoch reichen auch homöopathische Dosen, die Renovation eines Gebäudes und seine Um- oder Wiedernutzung, wie etwa beim Cabaret Voltaire in Zürich.
Genius loci – soziokulturelle Matrix
Architektonische Implantate können mit dem Stadtkörper verwachsen – etwa, wenn wie in Bilbao das umliegende Terrain einbezogen, die Ader des Flusses revitalisiert wird und Brücken wie Gefässe das neue Organ versorgen – oder auch nur, wenn körpereigene Zellen transplantiert werden –, die Treppe in der Erweiterung des Kunsthauses Aarau von Herzog & de Meuron als Referenz an die existierende Spindel, die Adaption der traditionellen Azulejos in OMAs Casa da Musica in Porto, die ansonsten auch mit einem Meteoriten verglichen wurde. Und als solcher kann der Fremdkörper natürlich auch einen Virus einschleppen. Aber anders als in der Medizin lassen sich eine Stadt und ihre Bewohner zuweilen gern von ihm infizieren, anstecken von dem Neuen, das zum Körpereigenen mutieren kann.
Doch die medizinischen Metaphern implizieren auch potenzielle soziale Abstossungsreaktionen des Stadtkörpers, des durch Menschen belebten Organismus, die den kulturellen Austausch ausmachen. Denn «dieselben» Makrophagen und Lymphozyten, welche die Wundheilung fördern, stellen auch die Immunabwehr: «Ob Gehrys Wunderbau der Stadt tatsächlich ein kulturelles Herz einpflanzen kann, obwohl die Büromenschen nach Dienstschluss auf dem schnellsten Weg zu den Parkplätzen hasten, die wenigen Take-away-Schnellrestaurants ihre Rollläden herunterlassen und der Distrikt sich nach Einbruch der Dunkelheit in ein zugiges, unwirtliches Revier verwandelt?», fragte sich Claus Spahn angesichts der von Frank O. Gehry in Los Angeles gebauten Walt Disney Concert Hall.[8]
Wenn der gesellschaftliche Kitt, die soziokulturelle Matrix versagt, fehlt der Nährboden. Das Implantat verkümmert und muss eines Tages amputiert werden...
Anmerkungen
[1] Jörg Gleiter: Vom speechact zum sketchact – Architektur als Technik des Körpers, in: Wolkenkuckucksheim, Thema, Urban Bodies, 7. Jg., Heft 1, September 2002.
[2] Daniel Buser, Professor Universität Bern, zitiert in: Thomas Vaulthier: Osteology-Stiftung. Implantologie Journal, 5/2004.
[3] Dokumentation des Bundesministeriums für Bildung und Forschung: Regenerative Medizin und Biologie – Die Heilungsprozesse unseres Körpers verstehen und nutzen, S. 18.
[4] Urs Meier: Auf dem Weg zu intelligenten Baumaterialien, tec21, 19 / 2003, S. 6–9.
[5] Hermann Czech / Wolfgang Mistelbauer: Das Looshaus. Wien 1968, S. 31, zitiert nach: Jörg Gleiter: Vom speechact zum sketchact – Architektur als Technik des Körpers, in: Wolkenkuckucksheim, Thema, Urban Bodies, 7. Jg., Heft 1, September 2002.
[6] Christian Holl: Leuchtender Kokon, tec21, 41 / 2005, S. 4–8.
[7] Le Corbusier: Leitsätze des Städtebaus, in: Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts. Ulrich Conrads (Hrsg.), Braunschweig u. Wiesbaden 1981, S. 89.
[8] Claus Spahn: Eine Rose für das kalte Herz. «Die Zeit» 30.10.2003, Nr. 45.
[1] Jörg Gleiter: Vom speechact zum sketchact – Architektur als Technik des Körpers, in: Wolkenkuckucksheim, Thema, Urban Bodies, 7. Jg., Heft 1, September 2002.
[2] Daniel Buser, Professor Universität Bern, zitiert in: Thomas Vaulthier: Osteology-Stiftung. Implantologie Journal, 5/2004.
[3] Dokumentation des Bundesministeriums für Bildung und Forschung: Regenerative Medizin und Biologie – Die Heilungsprozesse unseres Körpers verstehen und nutzen, S. 18.
[4] Urs Meier: Auf dem Weg zu intelligenten Baumaterialien, tec21, 19 / 2003, S. 6–9.
[5] Hermann Czech / Wolfgang Mistelbauer: Das Looshaus. Wien 1968, S. 31, zitiert nach: Jörg Gleiter: Vom speechact zum sketchact – Architektur als Technik des Körpers, in: Wolkenkuckucksheim, Thema, Urban Bodies, 7. Jg., Heft 1, September 2002.
[6] Christian Holl: Leuchtender Kokon, tec21, 41 / 2005, S. 4–8.
[7] Le Corbusier: Leitsätze des Städtebaus, in: Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts. Ulrich Conrads (Hrsg.), Braunschweig u. Wiesbaden 1981, S. 89.
[8] Claus Spahn: Eine Rose für das kalte Herz. «Die Zeit» 30.10.2003, Nr. 45.
Für den Beitrag verantwortlich: TEC21
Ansprechpartner:in für diese Seite: Judit Solt