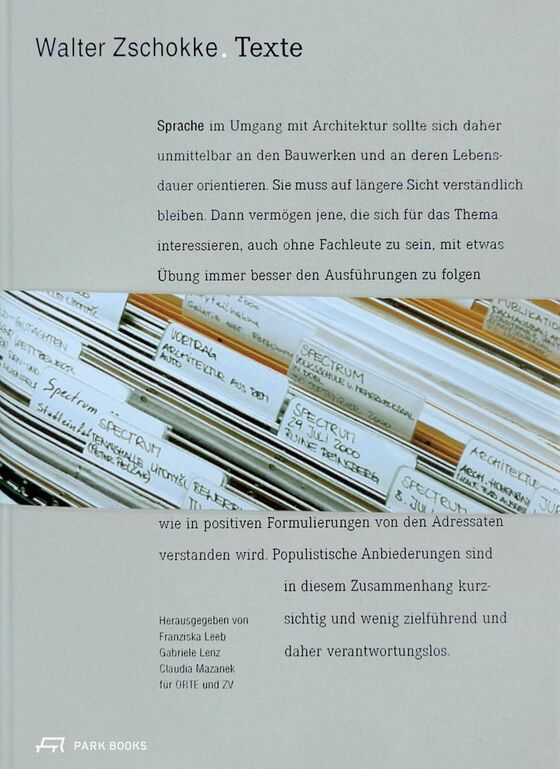Elegant ohne Balkon auf der Donau-City
Auf einem Restgrundstück in der Wiener Donau-City vermittelt ein Wohnturm jenes Weltstadtflair, dem es dem Stadtteil in großen Zügen fehlt. Wäre das nicht ein Ansporn zu weiteren Verbesserungen des Geländes?
Unter dem Motto „Brücken in die Zukunft“ sollte auf einer Überplattung der Donauuferautobahn die Expo 95 Wien an die Donau und in das 21. Jahrhundert katapultieren. Ein Referendum machte der Weltausstellung den Garaus, die Donau-City entstand dennoch peu à peu. Ein modernes zweites Stadtzentrum erträumten sich die Erfinder. Stattdessen: Unwirtlichkeit allüberall. Heftige Winde und sommerliche Überhitzung sind nicht die einzigen Plagen. Es fehlt an Aufenthaltsqualität und Orientierbarkeit. Hürdenläufe sind programmiert, ähnlich wie in Jacques Tatis futuristischem Paris der 1960er-Jahre, zwar weniger mondän, dafür gleichermaßen asphaltlastig. Die versprochenen herrlichen Zeiten blieben aus. Die Zwillingshochhäuser von Dominique Perrault sollten sich ergänzen wie die Hälften eines auseinandergeschnittenen Edelsteins. Statt des schnittigen Zwillings steht nun ein fader Nachbar vor der Fertigstellung.
Die Kante zum Ufer der Neuen Donau war als „Kulturfläche“ vorgesehen. Geblieben sind schallgedämmte Musikerapartments, Eigentumswohnungen, ein Low-Budget-Hotel, eine katholische Privatschule, die dem Opus Dei nahesteht, und ein „Innovationszentrum“, dessen Innovationsgehalt sich nicht so recht erschließen mag. Wirkt leider insgesamt eher wie Gigritzpatschen als das moderne Zentrum einer Weltstadt.
Bis auf den letzten Zentimeter
Seit Kurzem erhebt sich im Zentrum des Stadtteils ein neuer Turm über einem Restgrundstück, das zuvor als Parkplatz genutzt worden ist. Er gehört der Amisola, einem Unternehmen der Karl-Wlaschek-Privatstiftung, die auch Eigentümerin des benachbarten Andromeda Towers ist. Auf einem Garagensockel, der an eine bestehende Garage anschließt, entstand ein 18-geschoßiges Wohnhochhaus, dessen Figur genau das abbildet, was im Schattenwurf der benachbarten Hochhäuser zulässig ist und die Flächenwidmung noch hergab. Das Ausreizen bis auf den letzten Zentimeter ist die Ursache vieler Sündenfälle, in diesem Fall gelang durch das Stopfen eines Loches hingegen eine veritable Stadtreparatur.
Der von Jabornegg & Pálffy geplante Wohnturm zählt zu den wenigen eleganten Architekturen auf dem Gelände. Über einem unregelmäßigen Fünfeck-Grundriss errichtet, erscheint das Gebäude je nach Blickwinkel entweder als breite Scheibe, kompakter Polyeder oder schmaler Turm. Die bronzefarbene Metallelementfassade wirkt je nach Witterung weichgezeichnet schimmernd bis streng und fast schwarz. Dass es sich um keinen Bürobau handelt, verraten die französischen Fenster und die als Sonnenschutz in die Elemente integrierten gelochten Schiebeläden. Sie werden nicht automatisch gesteuert, sondern individuell manuell bedient, und sorgen so für ein bewegtes Bild innerhalb eines klaren Fassadenrasters, der mit seinem Relief Strukturen traditioneller Bauweisen aufnimmt. Üblicherweise gilt heutzutage eine Wohnung ohne Balkon als unvermietbar. Bei windexponierten Hochhauswohnungen führt dies mitunter zu bizarren Konstruktionen, mit denen die privaten Freiräume einigermaßen nutzbar gemacht werden. In diesem Fall waren sich Architekt András Pálffy und Amisola-Vorstand Friedrich Reisenhofer einig, dass auf dem engen Grundstück Balkone oder Loggien nicht sinnvoll wären. Der Verzicht geht nicht nur mit einer ruhigeren Optik einher, sondern auch mit einer besseren Tageslichtversorgung im Wohnungsinneren.
Der rötliche Teppich
Während schwer auffindbare Eingänge ein gemeinsames Leiden zahlreicher Gebäude in der Donau-City sind, gibt es beim DC Flats genannten Turm ein Entrée, das auf der Platte seinesgleichen sucht. Ein rötlicher Teppich aus kleinformatigem Porphyrpflaster führt auf das Gebäude zu und erstreckt sich vor der gesamten überdachten Erdgeschoßzone. Das ist nicht nur eine Geste, die das Ankommen inszeniert und der Orientierung dient, sondern erzeugt auch atmosphärische Wärme und Aufenthaltsqualität. Steinerne Bänke, ebenfalls aus Porphyr, und ein Pétanquefeld säumen den Zugang und haben das Potenzial eines Nachbarschaftstreffpunktes. Im rückwärtigen Garten mit Kinderspielplatz auf dem Garagensockel wird dieses Gestaltungsniveau leider nicht erreicht, immerhin entstand ein Stück mehr Grün. Aus den Erfahrungen im Altbau wussten die Bauherren von der großen Nachfrage nach kleinen Wohnungen mit einer Gesamtmiete unter tausend Euro. Ein Gros der 302 Wohneinheiten liegt daher im Segment der Ein-Zimmer-Wohnungen, es gibt aber auch große Familienwohnungen mit drei Zimmern und zwei Badezimmern. Die Zielgruppe: internationales Personal der in der Nachbarschaft angesiedelten Firmen und Institutionen, wie zum Beispiel der UNO, und auch Studierende.
Die Wohnungsmieten steigen mit der Höhenlage. Ein knapper Tausender für rund 45 Quadratmeter wird im freifinanzierten Bereich aber auch für deutlich unattraktivere Wohnungen verlangt, und in den aufgemotzten privaten Studierendenheimen kommt man meist auch nicht günstiger weg.
Einem Hotel nicht unähnlich
Die Wohnungen sind um einen dreieckigen Technik- und Erschließungskern angeordnet. An jedem der Gangenden sorgt ein französisches Fenster für natürliche Belichtung und Orientierung. Nur aus den wenigen gartenseitigen Erdgeschoßwohnungen und den Einheiten im zurückgesetzten obersten Geschoß mit dem umlaufenden Terrassenband kann man Getränkekisten nach draußen stellen. Die kleinen Wohnungen haben, einem Hotel nicht unähnlich, einen minimalistischen, gut durchdachten Grundriss. Eine Wandscheibe, die an der Fensterseite und im Anschluss an das nächst dem Eingang gelegene Bad Durchgänge lässt, trennt den Wohn-Ess-Bereich vom Schlafgemach. Kein Zentimeter wurde verschwendet. Unter den breiten Waschtisch passt die Waschmaschine, große Spiegelflächen verdecken die Revisionsschächte. Es sind einfache Maßnahmen, die für Großzügigkeit sorgen. Die händisch bedienbaren Schiebeläden laufen ruhig und klappern nicht, dazu solide Parkettböden und vom Tischler gefertigte Küchen – kein Luxus, aber ein solider gehobener Standard ohne Chichi.
Einem Investor und seinen Architekten war es ein Anliegen, es besser zu machen als die anderen. Wäre das nicht ein Ansporn zu einer gründlichen Reparatur des öffentlichen Raums der Donau-City unter Mitwirkung aller Profiteure und der Regie der Stadtplanung?