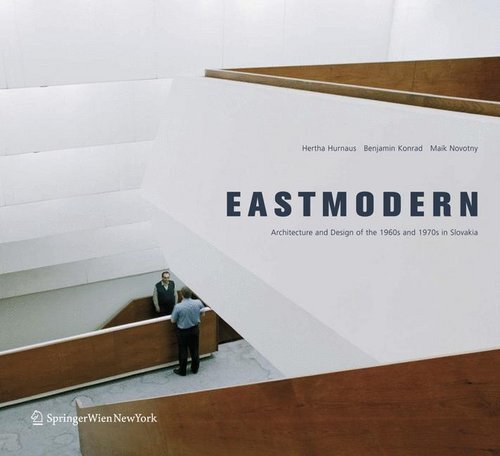Gemütlichkeit im Oktaeder
Eine Ausstellung im Kunsthaus Muerz in der Steiermark lotet die Faszination der Architektur für die Geometrie aus. Zwischen platonischen Körpern, rationalen Rastern und schrulligen Privatphilosophien wird Mathematik zum Wohnexperiment.
Die South Forest Avenue in Carbondale, Illinois, sieht aus wie tausende andere Vorstadtstraßen in den USA. Gepflegte, weiß getünchte Holzhäuser hinter Bäumen. Fährt man am Grundstück mit der Hausnummer 407 vorbei, bleibt man unweigerlich stehen. Eine kleine Kuppel, zusammengesetzt aus Dreiecksflächen, in Weiß und Blau. Hat hier ein Polarforscher testweise sein antarktisches Biwak aufgestellt?
Gefroren wurde hier nicht, geforscht schon. In dieser Kuppel residierten zwischen 1960 und 1971 Richard Buckminster Fuller und seine Frau Anne Hewlett Fuller. Sie war ein Testlauf für die 62 Meter hohe Biosphäre, die 1967 das Wahrzeichen der Expo Montreal werden sollte. Während jene von weltraumhafter Luftigkeit war, herrschte im Inneren von Herr und Frau Fullers Kuppel eher Zeltlager-Atmosphäre; ein kleines Opfer für das große Ziel des Selbstexperiments als Versuchskaninchen der Geometrie.
Zickzack-Ziggurat
Auch die Rue Gabriel Péri in Ivry-sur-Seine bei Paris lauert dem Flaneur mit einer geometrischen Überraschung auf. Ein Zickzack-Ziggurat aus Sichtbeton, von Grün überwuchert, das so organisch gewachsen wirkt, dass man erst auf den zweiten Blick bemerkt, dass es auf einem Raster von kristalliner Präzision komponiert ist. Die Komponistin: Renée Gailhoustet, die hier bis zu ihrem Tod 2023 auch selbst wohnte, in einem Fest der Diagonalen ohne rechten Winkel. Liberté in der regularité.
Wenn es um die Frage geht, wie bewohnbar die aufgezeichnete Idee ist, lässt sich die Antwort nur in der Selbsterfahrung geben. Der Schritt von Papier, Lineal und Zirkel in den Raum faszinierte den Wiener Architekten Martin Feiersinger schon zu seiner Schulzeit in Tirol. Seit über 40 Jahren sammelt er Grundrisse, die er selbst sorgfältig in Schwarz auf Weiß nachzeichnet. Wo andere abstrakte schwarz-weiße Muster sehen, entsteht in seinem Kopf sofort der dazugehörige Raum. „Man entdeckt schon beim Zeichnen sofort, wo der Raum funktioniert und wo nicht“, sagt er.
Barocke Kurvenlust
Jetzt hat er seinem Lebensthema gemeinsam mit der Architekturhistorikerin und Publizistin Gabriele Kaiser eine ganze Ausstellung gewidmet: Der Hang zu Geometrie im Kunsthaus Muerz. Hier ziehen sie punktgenaue Verbindungslinien durch Jahrhunderte und Kontinente, versammeln bekannte und unbekannte Architekten und deren Wohnexperimente aus 500 Jahren. Folgerichtig geht es hier zwei-, drei- und vieldimensional zu. Platonische Körper aus Baumaterialien pendeln von der Decke wie schwerelos gewordene Klettergerüste auf einem Spielplatz. Mathematik-Schulstunde trifft Kulturgeschichte, welterklärende Philosophien kollidieren mit individuellen Schrulligkeiten, barocke Kurvenlust wird durchkreuzt von asketischer Eckigkeit.
Den räumlichen Beginn markiert, augenzwinkernd selbstreferenziell, ein kleiner Vermessungspunkt in 1,50 Metern Höhe an der Wand. Den zeitlichen Beginn markieren Leonardo da Vincis 1509 veröffentlichte De divina proportione , Albrecht Dürers Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt von 1525 und Johannes Keplers Weltharmonik. „Nach Leonardo wurde die Geometrie zur Mode, und die von ihm wieder aufgegriffenen platonischen Körper zur Faszination“, sagt Martin Feiersinger.
Einladendes Durcheinander
Wer beim Thema Geometrie eine Ausstellung von eisiger Präzision erwartet (oder befürchtet), wird hier von einer Art einladendem Durcheinander überrascht, in dessen Linienmikado es reichlich irreguläre Zwischenräume gibt, die man selbst füllen kann. „Es war auch nicht unser Ziel, einen absoluten Kanon zu erstellen“, betont Gabriele Kaiser. „Doch gibt es mehrere rote Fäden, die sich durchziehen, etwa die Extreme von Minimum und Maximum bei den bewohnten Geometrien.“ Das Minimumextrem stellt hier Le Corbusiers Schreibhütte Cabanon in Südfrankreich dar, kaum mehr als ein Würfel, die Maxima finden sich vor allem in den hochkomplexen Hochämtern der Symmetrie des 18. Jahrhunderts.
Eine Auswahl von Martin Feiersingers Grundrissatlas – alle im Maßstab 1:50 – bildet den buchstäblich räumlichen Hintergrund der Ausstellung. Allein die zahllosen Varianten, mit denen Architekten versuchten, das zur Bewohnbarkeit leider unverzichtbare „Störelement“ einer Stiege in ihre perfekten Polygone zu integrieren, machen die Grundrisse zum sprechenden Narrativ. Nicht wenig Aufwand habe es gekostet, den tatsächlichen Maßstab alter Pläne herauszufinden, sagt Feiersinger. Schließlich konnte die Längeneinheit „Fuß“ je nach Zeit und Ort ganz unterschiedliche Zentimeterzahlen bedeuten.
Wem das Mathematiktrauma aus der Schulzeit bis heute eine Scheu vor gezeichneten Plänen beschert hat, darf sich zuerst am locker in den Raum gestellten Büchertisch festhalten, für den Feiersinger und Kaiser ihre privaten Bibliotheken temporär geplündert haben, von Baukunst-Folianten bis zu Max Frischs Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie und der Rechte-Winkel-Bibel des deutschen Architekten Oswald Mathias Ungers, in der er seine lebenslange Obsession mit dem Quadrat-Raster darlegte. Auch er war Bewohner seiner eigenen, eher ungemütlichen Geometrie, mehr zwänglerisch als elegant, wie eine Palladio-Villa, wenn Palladio an chronischer Verstopfung gelitten hätte.
Ebenfalls am Tisch: Inhabiting Geometry , publiziert von der US-Architektin Anne Tyng (1920–2011), eine der wohl faszinierendsten Entdeckungen dieser Ausstellung. Sie beschäftigte sich intensiv mit geometrischen Ordnungssystemen als Synthese von Mensch und Kosmos. Die göttlichen Proportionen der Renaissance trafen auf die Bewusstseinserweiterungen der amerikanischen LSD-Sixties. Ganz rational, versteht sich. Ein Tyng-Diagramm in der Ausstellung zeigt, in welche Sphären höherer Mathematik sie sich im Rausch der Fibonacci-Sequenzen hineinschraubte. Aber auch sie bewohnte ihre eigenen Regeln: Der winzige Dachaufbau des Tyng House in Philadelphia entrang der hyperrationalen Ineinanderverschachtelung eine stubenhaft warme und ausgezeichnet benutzbare Behaglichkeit. Auch Polygone können gemütlich sein.