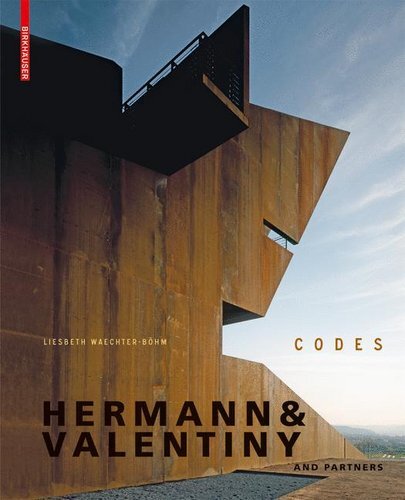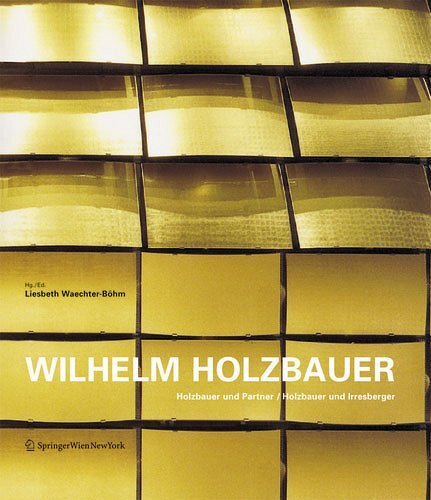Acht Jahre Arbeit
Die Evangelische Schule von Theophil Hansen am Wiener Karlsplatz: Nach langen Jahren des Umbaus nimmt eine zukunftsweisende Schultypologie Form an. Nur der neue Turnsaal, der bleibt ein frommer Wunsch des Architekten.
Vermutlich ist es der Alptraum eines jeden Architekten, wenn er in ein Projekt acht Jahre Arbeit investiert und dann so relativ wenig davon sichtbar wird. So muss es aber Martin Treberspurg und seinen Projektleitern – den Architekten Christian Wolfert, Partner im Büro, und Manuel Schweizer sowie Annemarie Mladek, Architektin und seit Langem der evangelischen Gemeinde Wiens verbunden – ergangen sein: Planen Schritt für Schritt, je nach der finanziellen Lage, Bauen hauptsächlich in den Schulferien. So viele Jahre. Und kaum einer nimmt den Generalsanierungsfall Evangelische Schule am Wiener Karlsplatz wahr. Dabei geht es um einen Theophil-Hansen-Bau von 1861 und um eine großartige, zukunftsweisende Schultypologie.
Hansen hat das Gebäude im Stil der italienischen Renaissance entworfen; ein „gnädiges“ Grundstücksgeschenk des Kaisers machte es möglich. Bis heute steht im Grundbuch, es muss eine Schule sein, und wahrscheinlich steht sie deswegen noch und nicht irgendein Hotel. Unter den Nazis zur Volkssturmkaserne umgewidmet, wurde sie beim Einmarsch von den eigenen Leuten angezündet. Zwei Tage und zwei Nächte hat sie gebrannt, den gelagerten Sprengstoff haben Bewohner hinausgetragen. Der Wiederaufbau (1954–1961) erfolgte durch Freiwillige, Kriegsdienstverweigerer und Pazifisten aus religiöser Überzeugung, übrigens ganz unterschiedlicher Nationalität.
Die Folge waren viele, viele Mangelerscheinungen, die auch an die Substanz des Konzepts von Hansen gingen: Der zentrale, glasüberdachte Innenhof, um den die Klassen – 1861! – organisiert waren, wurde nicht mehr überdacht. Die schönen Arkadenumgänge wurden mit Türen und Fenstern geschlossen. Von Energieeffizienz keine Rede, dafür fehlte es an Bewusstsein und den entsprechenden Baustoffen. Platznot herrschte von Anfang an, obwohl Hansens Entscheidung, an der verkehrsreichen Wiedner Hauptstraße keine Unterrichtsräume, sondern Geschäfte und Wohnungen anzuordnen, Klassenzimmern gewichen war.
Treberspurg & Partner Architekten haben gewissermaßen bei der Eingangstür begonnen: Sie wurde „umgedreht“, weil sie tatsächlich noch nach innen aufgegangen ist. Ein gläserner Windfang definiert diesen Eingangsbereich. Und dann kommt man auch schon in den wiederhergestellten Innenhof. Dort wurden alle Einbauten entfernt, wurde die Bausubstanz saniert, die Glasüberdachung macht im Verein mit einer Fußbodenheizung wieder einen echten Innenraum daraus. Und der ist technisch so ausgerüstet, dass man ihn für Veranstaltungen, etwa Konzerte, nutzen kann. Akustisch sind die Voraussetzungen dafür bestens. Und das ist wichtig, weil hier neben einer Volksschule, einer „Wiener Mittelschule“ und einem Hort mit Vorschulklasse auch die JSB (Johann Sebastian Bach) Musikschule untergebracht ist. Was Generalsanierung bedeutet, kann man sich vorstellen: Alles neu, was nicht unmittelbare Gebäudesubstanz ist; in diesem Fall aber auch eine neue Dachkonstruktion, natürlich in Stahl und auf Stützen, die den heutigen Brandschutzbestimmungen entspricht; Wärmedämmung; und eine Dachverblechung aus Aluminium, die sich mit ihrem Grünton auf die oxidierten Kupferdächer der Gründerzeit bezieht. Die wichtigsten architektonischen Maßnahmen bestehen in der Überbauung der beiden Lichthöfe, die zuvor Nebenräume belüftet haben, und im Ausbau des Dachgeschoßes. Jetzt sind in den überbauten Lichthöfen Garderoben untergebracht, sodass die gut belichteten Räume, wo sie zuvor waren, den Klassen zwischengeschaltet werden konnten und die Unterrichtsmöglichkeiten erweitern. Treberspurg hat übrigens Hansens Überlegungen bezüglich der Hausseite zur Wiedner Hauptstraße beachtet, dort wurde eine kontrollierte Komfortlüftung installiert, die Fenster können geschlossen bleiben.
So richtig zeitgenössisch geht es vor allem im ausgebauten Dachgeschoß zu, wo der Direktions- und Lehrerbereich eine neue, durchaus großzügige Unterkunft gefunden hat: Belichtet durch hier gestattete Dachflächenfenster (an der Schauseite des Hauses strikt untersagt) und über die Glaswände zum Gang hin auch mit dem Ausblick auf eine kleine Terrasse. Davon gibt es jetzt zwei, jeweils über den überbauten Lichthöfen, und dazu noch eine sehr große Terrasse über dem Mitteltrakt. Auch die Bibliothek fand hier Platz, wiewohl sie Lesesaal heißt (Bauvorschriften).
Die Bauvorschriften, die Brandschutzbestimmungen, das Geld: Um diese Parameter dreht sich hier alles. Dem Hansen-Bau sollte kein Schaden zugefügt werden, aber es bedurfte komplexer Überlegungen und einer Tüftelei um Zentimeter. Der Brandschutz etwa hätte ein zweites Stiegenhaus erfordert, dafür war im Haus selbst aber kein Platz, man hätte es außen dran stellen müssen. Jetzt ist jede Klasse ein eigener Brandabschnitt mit Fluchtmöglichkeit über die Haupttreppe, der zweite Fluchtweg sind die Fenster – das Haus steht frei und ist für die Feuerwehr rundum zugänglich.
Die Sicherheitsbestimmungen hätten Schlimmes anrichten können, verstärkt durch die Ängste der Lehrer. Denen wäre am liebsten gewesen, die Brüstungen in den Arkaden zu erhöhen und zusätzlich vollflächig mit Netzen zu sichern. Das wurde abgewendet, eine dezent zurückgesetzte Verglasung auf den Brüstungen des Bestands erfüllt alle Anforderungen und tritt visuell kaum in Erscheinung. Dass man sich beim Innenausbau aus finanziellen Gründen sehr zurücknehmen musste, empfinde ich nicht als Mangel. Das hat eher für eine gewisse Selbstverständlichkeit gesorgt, die in aller Schlichtheit mehr überzeugt, als es kostspielige Kapriolen je könnten.
Martin Treberspurg hätte gern im Zwischenraum zwischen Technik und Evangelischer Schule unterirdisch einen ordentlichen Turnsaal für die Schule gebaut, der jetzige ist zu klein. Aber dafür gibt es kein Geld. In den Bundesländern ist eine Drittelfinanzierung – ein Drittel Betreiber, ein Drittel Land, ein Drittel Bund – gang und gäbe. Die Bundeshauptstadt hält sich jedoch bedeckt, weil die Evangelische Schule eine Privatschule ist. Wie heißt dieser werbewirksame Slogan doch so schön? Wien ist anders.